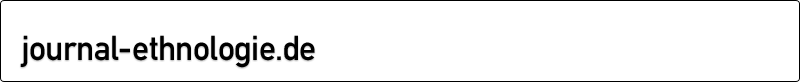
Von Dieter Kramer

Er hat Reiseberichte gelesen - aber was hat er daraus gemacht?
Alle feiern Schiller, weil der Ärmste vor 200 Jahren im Alter von 45 Jahren an vielerlei Krankheiten verstorben ist (10.11.1759 - 9. 5.1805). Dabei kennen die meisten ihn nur als kaum erträglichen Idealisten. Schon seine Studenten klagten über seinen unangenehm pathetischen und manierierten Vorlesungsstil. Und mit Sprüchen wie dem aus den Xenien kann er sich bei jeder modernen Frau lächerlich machen: Zeus zur Venus: Töchterchen, dein Geschäft sind nicht die Werke des Krieges,/ Gehe du heim und besing Werke der Liebe, der Lust. (Xenien. Ich zitiere nach Friedrich Schiller: Sämtliche Werke in fünf Bänden. München: dtv 2004, hier I, 323).
Können Ethnologen ihm heute etwas abgewinnen? Gereist ist er eher wenig – von Stuttgart bis Weimar, das war sein Lebenskreis, einige Kuraufenthalte dazwischen. Aber Reiseberichte seiner Zeit interessierten ihn. Im Brief an Goethe bekennt er, im Winter 1797/98 viel davon gelesen zu haben. James Cook wird ihm allerdings nicht wie den modernen Ethnologen zum Beispiel einer komplizierten Kulturbegegnung, sondern zum moralischen Motiv: „Es ist keine Frage, dass ein Weltentdecker oder Weltumsegler wie Cook einen schönen Stoff zu einem epischen Gedichte entweder selbst abgeben oder doch herbeiführen könnte; denn alle Requisite eines epischen Gedichts … finde ich darin… Es ließe sich ein gewisser menschlicher Kreis darin erschöpfen, was mir bei einem Epos wesentlich deucht, und das Physische würde sich mit dem Moralischen zu einem schönen Ganzen verbinden lassen.“ Aber zu einem Drama taugt ihm der Stoff nicht. „Da inkommodiert mich die sinnliche Breite ebenso sehr, als sie mich dort anzog; das Physische erscheint nun bloß als ein Mittel, um das Moralische herbeizuführen.“ (13.2.1798; die Briefe werden zitiert nach Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. In zwei Bänden, hg. von Ernst von Bracken. Berlin o.J., hier: 2, S. 47; vgl. III, 973 Kommentar).
Schillers Moralität und Goethes Hinweis auf die Lokalität
Schiller wundert sich, dass Goethe solche Stoffe noch nicht behandelt hat. Dieser, voll von seinen Studien zur Farbenlehre eingenommen, entgegnet (Brief 422, Briefe 2, S. 48) und fügt, sich auf die Lokalität beziehend, eine interessante Wendung hinzu: „…ich würde nie wagen, einen solchen Gegenstand zu behandeln, weil mir das unmittelbare Anschauen fehlt und mir in dieser Gattung die sinnliche Identifikation mit dem Gegenstande, welche durch Beschreibung niemals gewirkt werden kann, ganz unerlässlich scheint. Überdies hätte man mit der Odysee zu kämpfen, welche die interessantesten Motive schon weggenommen hat. Die Rührung eines weiblichen Gemüts durch die Ankunft eines Fremden, als das schönste Motiv, ist nach der Nausikaa gar nicht mehr zu unternehmen. … Die Narine Vaillants, oder etwas ähnliches, würde immer nur Parodie jener herrlichen Gestalten bleiben.“ (Briefe II 49) Ohne die „unmittelbare Anschauung“ wirkt nur der „sittliche Teil“ des Gedichts. „In welchem Glanze aber dieses Gedicht vor mir erschien, als ich die Gesänge desselben in Neapel und Sizilien las! Es war mir, als wenn man ein eingeschlagnes Bild mit Firnis überzieht, wodurch das Werk zugleich deutlich und in Harmonie erscheint. Ich gestehe, dass es mir aufhörte, ein Gedicht zu sein, es schien die Natur selbst, das auch bei jenen Alten um so notwendiger war, als ihre Werke in Gegenwart der Natur vorgetragen wurden. Wie viele von unsern Gedichten würden wohl aushalten, auf dem Markte oder sonst unter freiem Himmel gelesen zu werden.“ (Briefe II, S. 49/50).
Goethe tritt uns hier entgegen als jemand, der für die Lokalität sensibilisiert, und das muss eigentlich auch Ethnologen interessieren. In Zeiten der „Wiederentdeckung des Raumes“ (Niels Werber) und des faszinierten Blickes auf die wechselseitige Durchdringung von Globalisierung und Lokalität ( Glokalisierung ) ist das nicht uninteressant. Goethe, wie Aristoteles in Raffaels „Schule von Athen“ auf die Erde weisend, Schiller wie Plato ins Reich der Ideen blickend, dort freilich auf wirkungsvolle Weise Höhen und Tiefen des moralischen Menschen ausleuchtend, und darin liegt für mich eine besondere Leistung.
Vielleicht, weil daran erkennbar war, zu was Menschen fähig sein können, haben ihn auch die Gesetze für die indianischen Untertanen fasziniert, die der Jesuitenregierung in Paraguay zugeschrieben wurden (Jesuitenregierung in Paraguay. IV, 985-987; abgeschrieben ist der Text aus Johann Christoph Harenbergs Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten von 1760, 2, 2243ff., IV, 1066 Komm.). Sie heute zu lesen, ist eine Entdeckung, denn sie erinnern in ihrer bedingungslosen Feindschaft gegen Europäer, der absoluten Unterwerfung unter die Religion und durch die maßlosen Versprechungen bezüglich sexueller Genüsse im Himmel für die Opfer frappierend an heutige islamistische Vorstellungen.
Texte dieser Art sind – wie die von Herder, Rückert, Chamisso, Lenau, Raabe und vielen anderen – Material für eine Studie über die Verquickung der deutschsprachigen Literatur mit der Eroberung der Welt, mit denen das auf das anglophone und frankophone Westeuropa konzentrierte Bild von Edward Said in seinem Kultur und Imperialismus (Frankfurt am Main 1994) modifizierend-ergänzend korrigiert werden könnte.
Schillers Gegenspieler-Modell als Abwehr von Hegemonieansprüchen
Etwas anderes bei Schiller ist mir in Zeiten der Globalisierung und neuen Hegemoniebestrebungen noch wichtiger. In der Auseinandersetzung mit dem moralischen Menschen entwickelt er sein „Gegenspieler-Modell“, mit dem er uns interessieren, ja vielleicht sogar mit seinem lebensfernen Idealismus versöhnen kann. Es ist enthalten in dem Text Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1793/94, V, 570-669), geschrieben an seinen Gönner Prinz Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augustenburg, einen Anhänger der französischen Revolution. In diesen Briefen zeigt Schiller der Fortschrittseuphorie die Grenzen und weist einen Weg, mit dem „alten Adam“ ohne eine idealistische, vernunftradikale Erziehungsdiktatur zurechtzukommen.
Diese Briefe beeindrucken heute nicht so sehr, weil sie, wie Kunstproduzenten es gern haben, die Künste ins Zentrum stellen, sondern weil das linear und universalistisch konzipierte Fortschrittsmodell von Immanuel Kant auf eindrucksvolle Weise dynamisiert und relativiert wird. Er schreibt: "Einheit fordert zwar die Vernunft, die Natur aber Mannigfaltigkeit, und von beiden Legislationen wird der Mensch in Anspruch genommen." (4, V, 577). Und in dieser Dialektik liegt Befreiung: "Sobald nämlich zwei entgegengesetzte Grundtriebe in ihm (dem Menschen) tätig sind, so verlieren beide ihre Nötigung, und die Entgegensetzung zweier Notwendigkeiten gibt der Freiheit den Ursprung." (19, V, 631) Dem Terror der (politischen, ökonomischen) Vernunft schreibt er ins Stammbuch: "Wenn das gemeine Wesen das Amt zum Maßstab des Mannes macht, wenn es an dem einen seiner Bürger nur die Memorie, an einem andern den tabellarischen Verstand, an einem dritten nur die mechanische Fertigkeit ehrt ... - darf es uns da wundern, dass die übrigen Anlagen des Gemüts vernachlässigt werden ... ?" (6, V 584) "Kann aber wohl der Mensch dazu bestimmt sein, über irgendeinem Zwecke sich selbst zu versäumen?" (6, V, 588) So entwickelt Schiller hier, die Widersprüche der Revolutionen seiner Zeit verarbeitend, ein attraktives Programm, weil es eine Perspektive für das individuelle und das gesellschaftliche Leben bietet, die Distanz und Entscheidungsfreiheit ermöglicht: „Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf“ (9, V 595), empfiehlt er seinem Gönner.
Der Kulturoptimismus der Universalgeschichte Schillers
Die Gedanken der „Briefe“ stehen für uns heute in merkwürdigem Kontrast zu dem aufklärerischen Monismus der Antrittsvorlesung „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ (IV, 749-767). Am 26. und 27. Mai 1789, wenige Wochen vor dem Sturm auf die Bastille (IV, 1056) und der damit beginnenden französischen Juli-Revolution, hält Schiller als Historiker seine Jenenser „akademische Antrittsrede“ unter dem Titel „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ (IV, 749-767).
Entwickelt wird das klassische evolutionistische Programm: „Die Entdeckungen, welche unsre europäischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Küsten gemacht haben, geben uns ein ebenso lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Völkerschaften, die auf den mannigfaltigsten Stufen der Bildung um uns herum gelagert sind, wie Kinder verschiednen Alters um einen Erwachsenen herumstehen und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, was er selbst vormals gewesen und wovon der ausgegangen ist. Eine weise Hand scheint uns diese rohen Völkerstämme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unsrer eigenen Kultur weit genug würden fortgeschritten sein, um von dieser Entdeckung eine nützliche Anwendung auf uns selbst zu machen und den verlornen Anfang unsres Geschlechts aus diesem Spiegel wiederherzustellen. Wie beschämend und traurig aber ist das Bild, das uns diese Völker von unserer Kindheit geben! und doch ist es nicht einmal die erste Stufe mehr, auf der wir sie erblicken. Der Mensch fing noch verächtlicher an. Wir finden jene doch schon als Völker, als politische Körper: aber der Mensch musste sich erst durch eine außerordentliche Anstrengung zur politischen Gesellschaft erheben.“ (754)
Keiner kann sich heute mit einem solchen Bild anfreunden. Die Gleichberechtigung der Kulturen, ihre vergleichbare Kapazität, ihr Leben und ihr Verhältnis zueinander sowie zu ihrer Umwelt zu organisieren ist Grundlage des Denkens der Kulturwissenschaftler geworden.
Die Polemik gegen die „Brotgelehrten“
Eine andere Passage aus der Antrittsvorlesung aber kann uns immer noch erfreuen. „Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt.“ (IV, 749, Hervorhebung DK): In diesem programmatischen Satz ist enthalten die Subsumption der Geschichte unter das Moralprogramm Schillers. Ihm geht es darum, sich als Menschen auszubilden (IV, 750) – bei Wilhelm von Humboldt lassen sich ähnliche Gedanken bezüglich der Ziele des akademischen Unterrichts finden. Und damit hängt die dann folgende Unterscheidung zwischen dem „Brotgelehrten“ und dem philosophischen Kopf zusammen, die heute wieder oder noch anwendbar ist – aber der „Brotgelehrte“ wäre, bezogen auf die Ethnologie z.B., nicht derjenige, der Angewandte Ethnologie betreibt, sondern eher derjenige, der die selbstreferentielle, nur in den Bahnen des Faches sich bewegende universitäre Ethnologie der Karriere wegen betreibt – „nicht bei seinen Gedankenschätzen sucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er von fremder Anerkennung, von Ehrenstellen, von Versorgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ist unglücklicher als der Brotgelehrte?“ (IV, 751) Dem „philosophischen Kopf“ geht es darum, die Einheit der Gegenstände wieder herzustellen: „Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frühe hat er sich überzeugt, dass im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, alles ineinander greife, und sein reger Trieb nach Übereinstimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen. Alle seine Bestrebungen sind auf Vollendung seines Wissens gerichtet; seine edle Ungeduld kann nicht ruhen, bis alle seine Begriffe zu einem harmonischen Ganzen sich geordnet haben …“ (IV, 752)
Klassiker zeichnen sich dadurch aus, dass die Lektüre ihrer Werke immer wieder anregend ist. Bei Schiller bestätigt sich das.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008