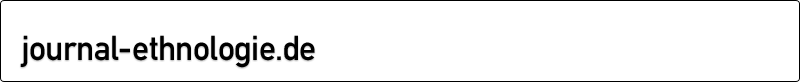
Sichten der Kulturwissenschaft
Von Dieter Kramer
Krieg ist selten total

Der Tübinger Volkskundler Hermann Bausinger zitiert ein Erzählmotiv aus der Schweiz: „Man weiß nicht mehr, ob es Kaiserliche oder Franzosen waren. Sie bestiegen die Bäume, hieben mit Säbeln die Äste ab und verspeisten die Kirschen am Boden.“ Bauernkriegschroniken berichten, dass die Kriegsführung der Herren sich dadurch von derjenigen der Bauern unterschied, dass erstere bei den Strafaktionen gegen die Bauern Obstbäume und Weinstöcke rücksichtslos abhacken ließen. Und in einer Darstellung der „Kronberger Fehde“ im Historischen Museum in Frankfurt ist als besonders darstellenswerte Episode festgehalten, wie die kriegsführenden Parteien Obstbäume abhacken. „Das ganze Elend des Krieges“, so Hermann Bausinger zu der von ihm zitierten Episode: die damals denkbare größtmögliche Steigerung der Brutalität des Krieges, die nicht nur das gegenwärtige Leben, sondern auch die Zukunft zerstört. Dass dies in Erzählungen und Bildern überhaupt erwähnt wird, deutet darauf hin, dass es selbst innerhalb der Gewohnheiten der Kriegsführung als etwas Nichtalltägliches betrachtet werden muss.
In der Tat: Der Normalfall der Konflikte zwischen Gemeinschaften, Ethnien, Völkern scheint nicht der „totale Krieg“ zu sein, sondern eine Kombination von Gewaltepisoden und Formen der Moderation von Interessen-konflikten. Zwischen der allüblichen, für das Überleben notwendigen Konstruktion von "Wir-Gruppen" und der Gewalt gegen andere bei Interessenkonflikten besteht kein zwingender Zusammenhang. Konflikt bedeutet zudem nicht automatisch Krieg als Massenkonflikt mit zentral gelenkter Organisationsstruktur auf beiden Seiten, Planmäßigkeit und Kontinuierlichkeit.
Immer wieder rivalisieren menschliche Gemeinschaften um Ressourcen und Territorien. Dabei werden kulturelle Unterscheidungen als am leichtesten benennbare Merkmale zur Unterscheidung von Freund/Feind benutzt.
Die Einhegung von Konfliktpotenzialen
Gewalt ist eine genauso genuin menschliche Verhaltensbereitschaft wie Altruismus und Mitleid. Aggression und Aggressionshemmungen werden im „Parlament der Instinkte“ koordiniert, und die Geschichte zeigt immer wieder, dass die Ergebnisse keineswegs zwangsläufig sind. Weder das eine noch das andere ist ausweglos vorgegeben.
Die Fähigkeit zur friedlichen Konfliktregulierung und zur Einhegung von Konflikten bei als unvermeidlich angesehenen, tiefgreifenden Unterschieden wird seit Jahrtausenden gepflegt: Konfliktverlagerung und kommunikative Konfliktbearbeitung gehören ebenso wie Konflikttraining und ähnliche Instrumente zur Grundausstattung all jener Lebensverhältnisse, in denen verschiedene ethnisch-kulturelle Gruppen an Grenzflächen aufeinandertreffen. Zu den Konfliktvermeidungsstrategien, mit denen potentielle Gegner als Partner das Chaos des nicht beherrschbaren und in seinem Ausgang absolut ungewissen Kriegs zu vermeiden suchen, gehört die ritualisierte Begegnung im Fest oder dem Kult (wie bei den Griechen) - Begegnungsformen, die auf einen gewissen (manchmal sehr geringen) Vorrat von Gemeinsamkeiten auf der Symbolebene setzen. In komplizierten Formen wird bzw. wurde vielfach die Nachhaltigkeit der Beziehungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften geregelt: Die Bambuspfeilspitzen rahaka werden im südamerikanischen Regenwald zwischen den Yanomami-Männern verschiedener Lokalgemeinschaften regelmäßig ausgetauscht, denn die Yanomami sind davon überzeugt, dass man mit denn selbst hergestellten Pfeilspitzen nicht treffen kann. In aktuellen europäisch-atlantischen Diskussionen beschwören die Kommunitaristen die inneren Bindekräfte kleiner Gemeinschaften - in den indianischen Kulturen weiß man anscheinend schon lange, dass die nicht ausreichen, sondern erweitert werden müssen auf die gewohnheitsmäßigen Bindungen an die Nachbargemeinschaften, wenn zerstörerische Konflikte vermieden werden sollen (Suhrbier).
Modernes Konfliktmanagement
Auch in der Gegenwart spielt Konfliktmoderation eine Rolle. Ausgehend von der Erfahrung, dass humanitäre Hilfsprojekte durch Krieg und Kämpfe zerstört werden, hat die katholische Laienorganisation Sant'Egidio in Rom in einigen Gebieten der Welt die Rolle des Vermittlers und Friedensstifters in Bürgerkriegen erfolgreich übernommen. Sie tut dies mit einer ausgereiften Dialog- und Vermittlungstechnik, bei der die beteiligten Kräfte zunächst dazu gebracht werden, anzuerkennen, dass sie demselben Land zugehören und de facto in gemeinsamer Verantwortung verbunden sind. Dabei wird niemand im Status des ausgegrenzten „Schurken“ belassen: "Um Menschen in die Beilegung eines politischen Konflikts einzubeziehen, die in den Augen der internationalen Gemeinschaft als Aussätzige gelten, musste eine gehörige Portion Mut aufgebracht werden." Geduld und Dauerhaftigkeit sind dann die weiteren unerlässlichen Komponenten von Versöhnungsgesprächen. Erst viel später können dann beide Seiten in „Wahrheitskommissionen“ Vergangenheit aufarbeiten.
Friedensfähigkeit
Aus der Fülle historischer Daten lassen sich einige Trends erkennen: „Die Kulturen, in denen der Krieg ein relativ unwichtiges politisches Instrument war, wie die des alten Ägypten, Sumers, des Alten China, dauerten am längsten“, stellt der Politologe Ekkehart Krippendorf fest. Plato „nennt Zusammenhalt der Bevölkerung und ein Wirtschaftssystem mit mäßiger Konsumhöhe als günstige Voraussetzungen für einen Staat, der sich aus Kriegen herauszuhalten wünscht.“ (Krippendorf).
Es gibt materielle Komponenten der Friedensfähigkeit einer Gesellschaft: Geringe Abhängigkeit von solchen lebensnotwendigen Ressourcen, über die andere verfügen (Erdöl oder Uran z.B., daher sind erneuerbare Energien wichtig für die Friedensfähigkeit), ferner eine gewisse Elastizität der Lebensweise, die nicht jede Einschränkung gleich als Katastrophe empfinden muss.
Gewaltmärkte
Moderne Kriegstheorien betrachten Krieg nicht mehr nur als „Pathologie, die im modernen Sozialen keinen bleibenden Ort beanspruchen kann; der Krieg soll verschwinden.“ (Dierk Spreen). Aber es fragt sich, „ob nicht gerade wesentliche Aspekte des Phänomens "’Krieg’ durch diese Verbindung von Wertung und Analyse verdeckt werden –Aspekte, über die genau Bescheid zu wissen, einer Politik, die den Frieden im Auge hat, nur dienlich sein kann.“ (Spreen).
An dieser Stelle wären mögliche Beiträge der Ethnologie zur Diskussion um Krieg und Gewalt zu verorten: Die „Rationalität“ der Gewaltanwendung, Rituale der Gewalt und der Kriegsführung, die gerade den alles zerstörenden „totalen Krieg“ verhindern sollen und Rituale der Konfliktmoderation, mit denen die Gewaltschwelle angehoben wird.
Ethnologen und Kulturwissenschaftler haben sich in jüngerer Zeit ausführlich mit Krieg und Gewalt in zerfallenden Staaten beschäftigt. Um die Gewaltmärkte und die „Ökonomie der Bürgerkriege“ (François und Rufin) geht es in zahlreichen Studien: Sowohl die sozialkulturellen Muster als auch die ökonomische Rationalität, genährt durch strategische Rohstoffe, Edelmetalle und „Blutdiamanten“, sind unverzichtbarer Teil der modernen Kriege. Herfried Münkler vergleicht die Kriege des Barock, den Dreißigjährigen Krieg mit den „neuen Kriegen“ außerhalb der europäisch-atlantischen Welt: „Kriegsunternehmer“, die auf Reichtum hoffen, spielen dabei eine zentrale Rolle. Aus dem Zerfall der Staaten z. B. in Afrika entstehen die neuen Söldnerarmeen.
Die Diskussionen der Philosophen und Politiker über „gerechte Kriege“ und Interventionen gegen Menschenrechtsverletzungen bergen einen Rattenschwanz von ungeklärten Fragen: Wer hat die Definitionsmacht? Entsprechende Definitionen sind nicht ohne kulturspezifische Wertungen möglich, und angesichts des Spielraums von Interpretationen zeitigt jeder Sieg im „gerechten Krieg“ die Gefahr einer Folge von weiteren Kriegen, in denen wieder andere Maßstäbe gesetzt werden. Und selbst wenn eine breite Koalition Einigung erzielt z.B. über die Sanktion von Menschenrechtsverletzungen, so ist die Zahl der Staaten, in denen solche Interventionen geboten wären, unendlich groß (wo wird nicht überall mit der Todesstrafe gegen Menschenrechte verstoßen?). Die erwähnten Techniken der Moderation scheinen da interessanter.
Intervention oder Moderation?
Auch die Diskussion um den „modernen Interventionismus“ und „neuen Kolonialismus“ wird dies zu berücksichtigen haben. Der Tübinger Ethnologe Thomas Hauschild vertritt beides. Er empfiehlt den Vertretern der antikolonialistischen Debatte, „die jetzt entstehenden modernen Formen von Schutzgebieten und Protektoraten als Realitäten zu begreifen und sie in der für alle Beteiligten bestmöglichen Form zu übernehmen, bis ihre Bevölkerung sich in einer globalisierten Welt zivilgesellschaftlich selbst verwalten und repräsentieren kann“ (wie 1945 in Deutschland). Er meint: „Ob es uns passt oder nicht, der Westen wird die Verantwortung für Versorgung und Verwaltung bestimmter Regionen übernehmen müssen, statt mehr oder weniger wolkig von UN-Schutzgebieten und Sonderverwaltungsbezirken zu reden.“
Affirmiert wird damit die politisch gewollte Entmachtung der UN. Andere Möglichkeiten werden verbaut. Die Enttäuschungen bezüglich der UN und anderer internationaler Organisationen, über die sich Thomas Hauschild von Experten vor Ort hat erzählen lassen, können heute leicht auch auf die Protektoratsregime der Großmächte bezogen werden.
Hauschild meint: „Wir stehen vor der Aufgabe, einen nichtkolonialen und nichtrassistischen Kolonialismus zu denken“, meint Hauschild, und empfiehlt dabei, „koloniale Dummheit“ möglicht zu vermeiden. „Diese Aufgabe ist paradox, denn wie sollen wir die islamistische Weltbewegung durch Überzeugungsgesten von ihrem Unrealismus abbringen, gleichzeitig die Ratio auch westlicher ‚Falken’ respektieren lernen und dennoch versuchen, beide im Zeichen eines Ideals von Realismus und Zivilgesellschaft zu besänftigen? Ein neuer differenzierter Materialismus sollte die technische Abstraktion des Fremden wie seine idealistische Überhöhung durchbrechen.“
Aber vielleicht existieren dafür schon wichtige Ansätze? Die Denkfigur vom „aufgeklärten Eigeninteresse“ (enligthed self-interest) gehört dazu, vor allem aber auch die Strukturen, die, in dem von Kofi Annan herausgegebenen Manifest „Brücken in die Zukunft,“ von Denkern aus Nord, Süd, Ost und West entwickelt wurden, sind Beispiel dafür. Unter den Auspizien von „Wandel durch Annäherung“ (immerhin schon einmal mit gewissen Erfolgen praktiziert) und „gemeinsamer Verantwortung“ (ebenfalls auf zahlreichen Feldern schon seit dem Brundtland-Bericht wirkungsvoll, wenn auch nicht durchschlagend und flächendeckend erfolgreich) lässt sich ein Dialog auch mit grundsätzlich unterschiedlichen Denkweisen strukturieren und moderieren. Das angemaßte Deutungsmonopols hegemonialer Weltmächte und Interventionisten steht konträr dazu.
Verknüpfen lassen sich solche Vorstellungen mit manchen aktuellen, optimistischen, universalhistorischen Perspektiven: Paul Raskin vom Stockholm Invironment Institute SEI in Boston kann sich anstelle eines Szenarios der Barbarisierung und des ökologischen Zusammenbruchs mit einer durch Kriege des Hegemons oberflächlich befriedeten, neuen Apartheid auch ein „neues Nachhaltigkeits-Paradigma“ vorstellen, „in dem eine effiziente, ökologisch verträgliche Technik und veränderte, „postmaterielle“ Werte ein gedeihliches Leben von demnächst neun Milliarden Menschen auf dem Globus ermöglichen. Neue Allianzen und Formen des akzeptierten Krisenmanagements durch das „Empowerment“ von internationalen Organisationen zeichnen sich ab, und der Schlüsselbegriff vom „aufgeklärten Eigeninteresse“, dem alle in gemeinsamer Verantwortung folgen, hat hier durchaus Chancen.
Literaturhinweise:
Mona B. Suhrbier: Überwindung von Fremdheit durch Verwandlung. Multikulturalität bei Indianern im Amazonasgebiet. In: Mona B. Suhrbier (Hg.).: Fremde. Die Herausforderung des Anderen. Frankfurt am Main: Museum für Völkerkunde 1995 (Roter Faden zur Ausstellung 20), S. 219-249.
Eva Ch. Raabe: Verwandtschaften schaffen. Aggression und Integration aus ethologischer und ethnologischer Sicht. A.a.O. S. 189-218.
Erwin Orywal: Krieg als Konfliktaustragungsstrategie. Zur Plausibilität von Kriegsursachentheorien aus kognitionsethnologischer Sicht. In: Zeitschrift für Ethnologie 121 (1996), 1-48, 6/7 (eine Diskussion dazu a.a.O. S. 49-99)
Erwin Orywal, Aparna Rao, Michael Bollig (Hg.): Krieg und Kampf. Die Gewalt in unseren Köpfen. Berlin: D. Reimer 1996
Philippe Leymarie: Zauberkünstler in Sachen Diplomatie: Die Friedensstifter von Sant'Egidio. In: In: Monde diplomatique/Tageszeitung Sept. 2000, S. 20-21.
Roberto Morozzo della Rocca: Die Friedensarbeit der Communità di Sant'Egidio - Verlaufsprozess einer ungewöhnlichen Mediation. In: Peripherie (Berlin/Münster) Nr. 79, 20. Jg. 2000, S. 69-87.
Dierk Spreen: Grammatik des Krieges. Kriegstheorien im Überblick. Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 5/2003 S. 23-30.
Jean François, Jean-Christophe Rufin: Ökonomie der Bürgerkriege. Hamburg 1999 (Hamburger Edition)
Thomas Hauschild: Die Welt ist nicht genug. Warum ein neuer Kolonialismus für Afghanistan, Irak und andere die einzige Chance ist. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 20.04.03.
Brücken in die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der Kulturen. Eine Initiative von Kofi Annan. Mit einem Geleitwort von Joschka Fischer. Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2001.
Kriege sind nicht ethnisch. Berliner Blätter. Ethnographische und Ethnologische Beiträge 21/2000, S. 95-97.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008