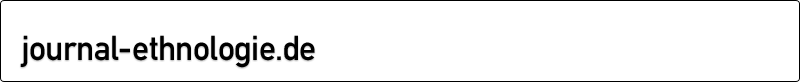
Von Henry Kammler

Vielleicht war am Anfang nicht das Wort, aber als es auftauchte, wurde der Mensch zum Menschen, zum Homo sapiens. Denn individuelle Erfahrungen wurden erst in Worten mitteilbar und dadurch zu kollektivem, geteiltem Wissen, das auf diese Weise, vom Einzelnen abgelöst, in ständigem Wandel fortleben konnte. Sprache ist also in allen ihren Erscheinungsformen ein zentraler Bestandteil von Kultur. Diese Einsicht hat sich in der Ethnologie erst nach und nach etabliert. Frühe Völkerbeschreibungen verließen sich weitgehend aufs Beobachten, aufs Sammeln materieller Güter und die Aufzeichnung schriftlicher Zeugnisse mittels Übersetzern. Indigene Sprachen waren nur Mittel zum Zweck. Und da, wo sie zum Gegenstand der Forschung gemacht wurden, bei den Linguisten, übersah man bei allem Bemühen, der gehörten lautlichen Form eine adäquate Schreibung zu geben und formale Elemente und Regeln der jeweiligen Sprache als Zeichensystem zu rekonstruieren, dass sich Sprache immer in einer konkreten Situation in einer konkreten Kultur manifestierte. Immerhin wurde schnell klar, dass selbst noch so „einfache“ Kulturen höchst komplexe Sprachen aufwiesen. Man beschäftigte sich nicht mit dem kulturellen Akt des Sprechens, sondern mit der jeweiligen Sprache in ihrer vom Forscher selbst verschrifteten Form. Und ohne genau zu benennen, was eigentlich der Unterschied zwischen Kulturen ohne eigene Schrift („orale“ Kulturen) und Schriftkulturen ist, erkor man zum Gegenstand der Ethnologie die „schriftlosen“ Kulturen und überließ der Soziologie die Schriftkulturen.
Die Entdeckung des Sprechens
Es war nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Aufzeichnungstechniken, die immer deutlicher machte, dass ethnologische Forschungen der Dramatik, dem Ausdruck, der lautlichen Gestalt des Sprechens und dem Zusammenspiel von Sprechern und Angesprochenen, wie sie sich auf Film und Tonband dokumentieren ließen, bisher nicht gerecht worden waren. Und so entstand in den 1960er-Jahren eine „Ethnographie des Sprechens“ (D. Hymes). Unter Einbeziehung nichtsprachlicher Elemente wie Gestik und Mimik wurde ein Programm der systematischen Erforschung des Sprechens in den jeweiligen Kulturen entwickelt. Man untersuchte verschiedene Sprachstile, unterschiedliche Sprechweisen von Frauen und Männern, Alters- und Statusgruppen, Höflichkeitsformen, Zeremonial- und Geheimsprachen, elaboriertes Sprechen (wie Ansprachen, Zeremonialreden, Gebete, Lieder), Babysprache und Worttabus und fragte: Wann und warum wird laut oder leise gesprochen? Was bedeutet Schweigen? Es reifte die Erkenntnis, dass die mündlichen Überlieferungen, auch die zentralen Mythen des jeweiligen religiösen Denksystems, sich erst bei ihrer Aufführung in ihrer Bedeutung voll entfalten und durch das wiederholte Hören bei zahlreichen Anlässen sich tief ins kollektive Bewußtsein einnisten.
Hymes beschrieb typische strukturelle Merkmale mündlicher Textgenres, die einerseits die Botschaft verstärken und andererseits dem Erzähler die Erinnerung erleichtern. Dazu gehören vor allem inhaltliche Wiederholungen beziehungsweise Parallelisierungen von Episoden in so genannten „Sets“: In Europa gibt es zum Beispiel eine Vorliebe für drei parallele Episoden, etwa wenn drei Schwestern den Schuh anprobieren müssen (Aschenputtel), oder Rotkäppchen dem Wolf drei „Aber-Großmutter...“-Fragen stellt. Aller guten Dinge sind in unserer Erzählkultur eben drei, ein klares Erbe der ursprünglich nur mündlich überlieferten Haus- und Hofmärchen (bis die Grimms sie in eine feste schriftliche Form gossen). Weitere Merkmale mündlicher Texte sind formelhafte Wiederholungen (bei jeder Wiederholung wird nur ein Wort verändert), poetische Wiederholungen (Echos, Reime) und aufbauende Wiederholungen („x“, „x und y“, „x, y und z“). In jedem Fall wird klar, dass in dieser Form gesprochene Texte genauso wortwörtlich über viele Generationen hinweg überliefert werden konnten wie geschriebene.
Der breite Graben: Sprechen und Hören, Lesen und Schreiben

Sicher war eine der Zielsetzungen dieser Forschung auch, das Bild über die mentalen Fähigkeiten schriftloser Kulturen zu korrigieren, denen sich westliche Kulturen mit Verweis auf ihre (Buchstaben-)Schrift selbstverständlich überlegen fühlten. Was aber macht den Unterschied von schriftlich und mündlich geprägten Denkstilen tatsächlich aus? Die Herausbildung der abendländischen Wissenschaften ist ganz klar mit der Buchstabenschrift verbunden, die eine vorantreibende Suche nach Deutungen der Welt bei ständiger Rückversicherung auf die eigenen Quellen so erst möglich machte. Wilhelm v. Humboldt brachte es 1827 auf den Punkt: „Der erzeugte Stoff muss zu ruhiger, gesammelter, oft wiederkehrender Betrachtung da liegen, um klar und voll ins Bewusstsein zu treten ...“ Es lässt sich auch vermuten, dass die Niederschrift von Wissen den Geist der Wissenden von der Bürde befreite, alles auswendig lernen zu müssen, und sie diesen Freiraum für kühnere gedankliche Experimente nutzen konnten. Viele Forscher (zum Beispiel: J. Goody, M. McLuhan, W. Ong) gehen von einem scharfen Gegensatz von oraler und schriftlicher Kultur aus, auch wenn niemand bestreitet, dass sich im Geschriebenen wichtige Elemente der ursprünglich mündlichen Inszenierungen gehalten haben.
Eine neue Art von Kritik wurde möglich: Was einer gestern von sich gab, konnte in seiner schriftlichen Form nun direkt verglichen werden mit dem, was er heute behauptet.
Bei allen Unterschieden teilen aber Sprechen und Schrift ein banales, aber ganz grundsätzliches Problem: Sie drücken nämlich eine dreidimensionale Wirklichkeit, die aus allen Richtungen auf uns einstürzt, entlang einer Zeile aus: Silbe für Silbe, Buchstabe für Buchstabe. Die Expressivität von Sprache stößt so oder so an ihre Grenzen.
Gutenberg adé?
Ebenso wie Sprechen ist auch Lesen und Schreiben im jeweiligen kulturellen Kontext ein Gegenstand der Ethnologie. Einerseits ist die Frage, was mit schriftlichen Texten passiert, und zwar sowohl beim Niederschreiben (es „gerinnt“ ja kulturelle Praxis in Schrift) als auch beim (Vor-)Lesen (wo die Wirkung von Text Handlungen erzeugt). Andererseits ist die Frage, was „Übersetzen“ eigentlich ist: das Übersetzen von Flüchtigem in Dauerhaftes beim Niederschreiben, das Übersetzen von einer Sprache in eine andere und das Übersetzen von einer Kultur in eine andere. Kein Wunder, dass mancher Ethnologe seine Wissenschaft als „Übersetzungswissenschaft“ (B. Streck) definieren möchte.
Wie auch immer man sie abgrenzen mag: Die „Schriftkultur“ westlicher Prägung trat natürlich nicht plötzlich auf den Plan. Über viele Jahrhunderte führte sie ein privilegiertes, aber mikroskopisch kleines Eigenleben in klösterlichen Kopierstuben, auf gelehrten Konzilien und an weltoffenen Königshöfen. Erst der Buchdruck und die massenhafte Verbreitung von Schrifttum und Schriftkundigkeit brachte jene Schriftkultur hervor, die M. McLuhan so schön die „typographische Gutenberg-Galaxis“ nannte und die er damals, in den 1960er-Jahren, als in ihren letzten Zügen befindlich ansah. Für ihn war klar, dass der Fortschritt der elektronischen Medien der Mündlichkeit nicht nur neue Aufmerksamkeit der Ethnologen einbrachte, sondern die Vorrangstellung des geschriebenen Wortes zurückdrängte: Radio und Fernsehen bescherten dem gesprochenen Wort eine Renaissance. Man begann, von einer primären, traditionalen Oralität, die immer lokal bleibt, und einer modernen, sekundären Oralität zu sprechen, die weltumspannend ist.
Etwas verwundert, aber auch froh, einen neuen Forschungsgegenstand gefunden zu haben, stellten nun Ethnologen den durchschlagenden Erfolg von elektronischen Medien in den ehemaligen Kolonialgebieten fest, die meist nur oberflächlich alphabetisiert waren und diese neue Kommunikationsform offensichtlich direkt in ihre kulturelle Praxis integrierten. Allerdings erfuhren diese Medien sehr viel Förderung von den ansonsten selten wohltätigen Nationalstaaten und Ex-Kolonialmächten — Rundfunk und Fernsehen tragen nun patriotische Ideen und konvergierende Wertvorstellungen in die hintersten Ecken jedes Landes. Kontrolle über die Medien ist eine der wichtigsten politische Ressourcen. Hinter den sich entspinnenden Konflikten um Repräsentation in den Medien verbergen sich oft ganz alte Rechnungen.
Weltweites Geschwätz
Mit den Radio-DJs fing es an, aber das Internet machte es erst wirklich möglich: die direkte Kommunikation des Empfängers mit dem Sender. Geschriebener Text hält eine feste Stellung in den neuen Medien, aber in unterschiedlichster und nicht immer dem Verständnis zuträglicher Kombination mit Klang und Bild. Was Menschen inzwischen miteinander tun können, scheint sich zu wandeln und vor allem immer neue Reichweiten zu erlangen. Was bedeutet es, wenn ein Angestellter in Colombo mit einer wildfremden Hausfrau in Oehr-Erkenschwick seine Eheprobleme diskutiert oder ein Schulschwänzer in Kapstadt mit einer verwöhnten Bankierstochter in Yokohama „Halflife“ zockt? Oder wenn man es sich nur einmal die Woche leisten kann, im Phone Center an der nächsten Ecke, inmitten einer Menschentraube vor einem milchigen Bildschirm für 30 Minuten E-Mails zu checken, und dabei fast jedesmal der Strom ausfällt? Oder wenn über die Welt verstreute Chatter merken, dass sie alle Vorfahren in Wendisch-Rietz in der Lausitz haben und deswegen eine „Diaspora“ bilden? Oder wenn eine Guerilla-Bewegung aus dem mexikanischen Regenwald mit einer viersprachigen Homepage für ihre politischen Ziele werben kann? Das alles sind kulturelle Phänomene. Noch herrscht in der Ethnologie eine Art kreative (?) Verwirrung darüber.
Ob wir tatsächlich schon jenseits der Gutenberg-Galaxis sind? Mal ehrlich, hätten Sie diesen Text (wenn Sie so weit gekommen sind), nicht doch lieber sauber gedruckt auf schönem Papier gelesen?
Weiterführende Literatur
Brockmeier, Jens (1998). Literales Bewußtsein. Schriftlichkeit und das Verhältnis von Sprache und Kultur. München: Fink
Goody, Jack (1990). Die Logik der Schrift und die Organisation von Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp
Hymes, Dell (1979): Soziolinguistik. Zur Ethnographie der Kommunikation. Eingeleitet und herausgegeben von Florian Coulmas. Frankfurt/M.: Suhrkamp
McLuhan, Marshall (1995/1962): Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters, Bonn: Addison-Wesley
Ong, Walter (1987) 1982 : Oralität und Literalität: die Technologisierung des Wortes. Opladen: Westdeutscher Verlag
Schröder, Ingo W. / Voell, Stephane (Hg.)(2003): Moderne Oralität. Marburg: Curupira
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008