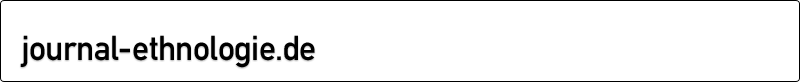
Wissenschaft in den Kategorien der Anderen
Von Lioba Rossbach de Olmos
Als „Kulturanalyse“ ( cultural analysis ) bezeichnete der 1995 verstorbene nordamerikanische Kulturanthropologe David M. Schneider seinen symboltheoretischen Ansatz, der freilich weniger Furore machte als der seines Weggefährten Clifford Geertz. Beiden gemeinsam war die Überzeugung, dass Kultur ein zusammenhängendes System von Symbolen und Bedeutungen darstellt, welches die Sinngebung einer Gesellschaft übernimmt und den Vorstellungen und Handlungen eine entsprechende Orientierung verleiht. Dies war das Erbe des großen nordamerikanischen Soziologen Talcott Parsons, der das kulturelle System einer Gesellschaft analytisch von dem sozialen System getrennt hielt und damit von der Auffassung der damals herrschenden ethnologischen Schulen abwich. Schneider hatte wie Geertz bei Parsons studiert, dessen Vorstellungen von Kultur wiederum von jenen Kulturanthropologen beeinflusst wurden, die, wie Geertz und Schneider, als Kriegsheimkehrer Ende der 40er-Jahre bei ihm an der Harvard-Universität studierten. Streit entzündete sich zwischen Schneider und Geertz um die Frage, wie man das Symbolsystem der Kultur zu analysieren habe: Aus sich selbst heraus und aus den Verweisen der einzelnen Symbole aufeinander, wie Schneider meinte, oder im Handlungsfluss, wie Geertz vorschlug, wodurch die beobachtbaren Handlungen in den Verstehensprozess einzubeziehen wären. Allerdings soll nicht dieser Streit, sondern der Wirbel, für den David M. Schneider in der Kulturanthropologie sorgte, im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Zunächst sei jedoch erwähnt, dass neben Talcott Parsons auch sein Förderer Clyde Kluckhorn Einfluss auf Schneiders Denken nahm wie auch nicht zuletzt Franz Boas. Obwohl Schneider sich selbst nie als Kulturrelativist bezeichnet hat, dürfte es wenige Anthropologen seiner Zeit gegeben haben, für die diese Bezeichnung treffender anzuwenden wäre. Schneider ging nämlich von einer Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Kulturen aus, deren Radikalität nicht einmal vor der eigenen Wissenschaft halt machte.
Relevant ist in diesem Zusammenhang Schneiders Überzeugung, dass die westliche Wissenschaft keine allgemeingültige objektive Wahrheit verkörpere, sondern selbst Teil eines Symbolsystems sei. Die vermeintlich kulturübergreifenden Kategorien, mit denen die Wissenschaft sich ihren Gegenständen nähere, ließen sich nach gründlicher Überprüfung als europäische Kulturkonstruktionen ausmachen. Da solche Kategorien auch die Grundlagen der Kulturanthropologie bildeten, müsse folglich ein Eurozentrismus innerhalb des Faches konstatiert werden. Wenn aber die wissenschaftlichen Begriffe selbst kulturgeprägt sind, lösen sich die starren Grenzziehungen zwischen wissenschaftlichen und fremdkulturellen Deutungssystemen auf und werden nivelliert. Damit erfuhren die fremden Symbolsysteme - die nicht weniger Sinnstiftung liefern als das wissenschaftlich-europäische - eine Aufwertung, ja es musste möglich sein, mit ihnen Wissenschaft zu betreiben. Nun war es nicht mehr ausreichend, im Gefolge von Claude Lévi-Strauss dem „Wilden Denken“ Logik, Kohärenz und eine eigene Struktur zu attestieren, sondern für Schneider galt es, dieses Denken in die Anthropologie hereinzuholen, d.h. die Wissenschaft in den Kategorien der Anderen zu betreiben.
Entwickelt hat David M. Schneider diese Überlegungen innerhalb der Verwandtschaftsethnologie, von der bis dato angenommen wurde, dass sie in der objektiv konstatierbaren biologischen Reproduktion des Menschen und den daraus resultierenden universellen Abstammungsbeziehungen fuße. Nicht der Gegenstand dieser Kritik war neu. Über das spezifische Verhältnis von Biologischem und Sozialem in dem, was die Ethnologie "Verwandtschaft" zu nennen pflege, hatten sich schon Anthropologengenerationen vor Schneider Gedanken gemacht. Auch die Zielrichtung der Kritik war nicht neu. Bereits Bronislaw Malinowski hatte davor gewarnt, „Übersetzungen“ von fremden Verwandtschaftsbeziehungen in unsere Kategorien vorzunehmen, weil die Bedeutung eine andere sein könnte. Neu war aber die Qualität der Kritik. Schneider machte nämlich in allen verwandtschaftsethnologischen Theorieansätzen - und zwar auch in solchen, sie sich exklusiv soziologisch gaben - das Wirken physisch-biologischer Vorstellungen aus, die er für Projektionen der in der westlichen Welt mit Verwandtschaft verbundenen Vorstellungen von Sexualität, Geschlechtlichkeit, Zeugung und Erziehung von Nachwuchs auf die fremde Kultur hielt. Der Verwandtschaftsethnologe fand in der Fremde, was er Zuhause gewohnt war zu treffen. Es wurden die eigenen Vorstellungen auf die fremde Wirklichkeit abgebildet.
Schneider sprach von der „Doktrin der genealogischen Einheit des Menschengeschlechts“, die der Verwandtschaftsethnologie zugrundeliege. Diese basiere auf falschen Annahmen. Die erste sei, dass alle menschlichen Kulturen eine Theorie der menschlichen Fortpflanzung oder ähnliche Überzeugungen von biologischer Verwandtschaft besäße oder dass alle menschlichen Gesellschaften gewisse Bedingungen teilten, die Bindungen zwischen dem Erzeuger und dem Kind und zwischen einem erziehenden Paar schaffen. Die zweite Annahme sei, dass solche genealogisch definierten Kategorien, die Bedeutung unabhängig vom größeren Zusammenhang der jeweiligen Kultur besäßen, vergleichbar seien. Eine Mutter gelte als Mutter in der ganzen Welt, selbst wenn Mütter sich in den fürsorglichen Aspekten unterscheiden. Ebenso sei es im Falle eines Vaters, Sohnes, einer Tochter, eines Bruder oder einer Schwester. Die dritte Annahme sei, dass die unterschiedlichen Vorstellungen über Fortpflanzung, die es in den Kulturen gäbe, nicht wirklich relevant seien. Es habe keine Folge für die unumstößliche Tatsache, dass eine abstrakte Genealogie „wahr“ sei, sie träfe auf alle menschlichen Kulturen zu oder, wie ich es hier nennen möchte, auf die ganze Menschheit.
Schneider vertrat die entgegen gesetzte Auffassung, dass nämlich die Existenz einer Fortpflanzungstheorie, selbst wenn diese der westlich-europäischen ähnelt, beileibe nicht ausreicht, um bei einer anderen Gesellschaft von Verwandtschaftsbeziehungen zu sprechen, sofern diese Beziehungen nicht auch die Bewertung und Bedeutung erfahren, die der „Verwandtschaft“ im europäischen Sinne entsprechen. Auf Grundlage von Studien über die nordamerikanischen Verwandtschaftsbeziehungen ist Schneider zu der Einsicht gelangt, dass dort die Vorstellungen über die Beziehungen zwischen den Verwandten, die inhärenten moralischen Gebote, ja die Termini selbst Teil eines eigenen kulturellen Systems seien. Verwandtschaft in diesem euro-amerikanischen Symbolsystem zeichne sich durch gemeinsame Substanz (genetische Ausstattung der Eltern) und eine diffuse, dauerhafte Solidarität (Liebe) aus. Dasselbe Symbolsystem könne aber in anderen Kulturen in dieser Form nicht vorausgesetzt werden. In einer späteren Veröffentlichung über die Jap-Insulaner wiederum, bei denen er einst nach dem Zweiten Weltkrieg geforscht hatte, nahm er keine Analyse in den verbürgt wissenschaftlichen, sondern in Kategorien vor, die er aus der indigenen Konzeptualisierung des Sozialen ermittelt hatte. Er gelangte damit zu völlig anderen Ergebnissen, als wenn er das Verwandtschaftssystem in den überlieferten wissenschaftlichen Kategorien beschrieben hätte. Schneiders Darstellung war zwar abstrakt und ist dafür auch kritisiert worden, aber sie kam näher an die Vorstellungen der Jap-Insulaner heran als jede andere.
Nach Schneider sollte sich der Ethnologe nicht mehr darauf konzentrieren, eine fremde Kultur und deren Realität in tradierte Kategorien der westlichen Wissenschaft zu übersetzen, sondern er hatte zuerst das fremde Symbolsystem zu ermitteln. Schneider hätte gesagt: „Wir sagen nicht: ‚Lass uns die Abstammungslinien betrachten!’; wir fragen statt dessen, welche Einheiten diese Kultur fordert, und die Antwort kann überhaupt nichts mit ‚Abstammungslinien’ zu tun haben.“ Das herkömmliche Verfahren, wissenschaftliche Kategorien der ethnographischen Wirklichkeit aufzustülpen und dabei unter Umständen einheimische Kategorien zu zerteilen oder gar zu zerstören, lehnte er völlig ab.
Dies setzte neue Fähigkeiten im Verstehen einer fremden Kultur voraus und die Aufgabe des Ethnographen wandelte sich. Beobachtung konnte nicht länger als bevorrechtete Methode der Feldforschung gelten. Das Gespräch, der Dialog mussten hinzutreten, was gegebenenfalls eine größere Kompetenz in der fremden Sprache voraussetzt. Die Anforderung, die Kultur aus sich selbst heraus zu erfassen, ist im Wesentlichen ein hermeneutischer oder interpretativer Prozess, der auf Verstehen des Anderen in dessen Kategorien zielt. Diese kulturellen Kategorien - handele es sich nun um einen Ahnen, die Familie, die Gemeinschaft oder einen Hilfsgeist des Schamanen – mussten als kulturelle Konstrukte verstanden werden, die in erster Linie aus der jeweiligen Kultur heraus zu definieren und zu verstehen waren.
Dies unterschied Schneiders Kulturanalysen von der verwandten Kognitiven Anthropologie, die mit ihren „emischen“ Begriffen ebenfalls bei den fremden Kategorien anzusetzen vorgibt, diese aber nach eigenen Erfordernissen aus der Wirklichkeit isolierte, um sie dann in verbindliche, formalisierte „etische“ Metakategorien zu übersetzen, die den Kulturvergleich ermöglichen sollen. Dass David Schneider solche Metakategorien nicht lieferte, wurde ihm kritisch vorgehalten. Ethnologie als vergleichende Wissenschaft könne ohne allgemeingültige wissenschaftliche Kategorien nicht betrieben werden.
Schneider fand wenig Zustimmung. Es war erkennbar, dass eine konsequente Anwendung seiner Ideen das Ende der Verwandtschaftsethnologie eingeläutet hätte, die in der Geschichte des Faches eine zentrale Rolle gespielt hatte. Aber auch so fand die Verwandtschaftsethnologie ein vorläufiges Ende. Mittlerweile gibt es keine führenden Anthropologen mehr, die sich intensiv mit Verwandtschaft beschäftigen, und verwandtschaftsethnologische Monographien sind rar geworden. David Schneider war der vielleicht letzte Vertreter der klassischen Verwandtschaftsethnologie, der aber daran mitgewirkt hat, sie zu Grabe zu tragen, auch wenn er es dann wieder begrüßte, dass sie in den Gay- und Genderstudien fort- bzw. wieder auflebte.
In Zeiten der Globalisierung mag es obsolet erscheinen, Gesellschaften als Einheiten mit jeweils eigenen Symbolsystemen zu begreifen. Zu vieles hat sich gemischt und ist heterogen und hybrid geworden. Zudem ließe sich der Begriff der „Kultur“, ohne den Schneiders theoretische Überlegungen hinfällig würden, vermutlich als ebenso eurozentristisch dekonstruieren, wie der der „Verwandtschaft.“ Was Schneider dennoch bis in die Gegenwart hinein interessant macht, ist sein Bestreben, die Welt aus kulturell unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und dabei offen zu sein für Einsichten, die nicht der tradierten Wissenschaft folgen. Zudem war er einer der ersten, der darauf hinwies, dass auch Wissenschaft kulturell geprägt ist. Diese Einsicht ist auch weiterhin bedenkenswert.
Weiterführende Literatur
Schneider, David M. (1968/1980): American Kinship, a Cultural Account. Second Edition. Chicago and London: The University of Chicago Press
Schneider, David M. (1984): A Critique of the Study of Kinship. An Arbor: The University of Michigan Press
Schneider, David (1995): Schneider on Schneider: The Conversion of the Jews and Other Anthropological Stories, as told to Richard Handler (Hrsg.). Durham, N.C.: Duke University Press
Feinberg, Richard und Martin Ottenheimer (Hrsg.) (2001): The Cultural Analysis of Kinship. The Legacy of David M. Schneider. Urbana and Chicago: University of Illinois Press
Zur Autorin
Dr. Lioba Rossbach de Olmos, Ethnologin, Forschungen zu Nicaragua und Kolumbien. Langjährige Mitarbeit im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder", zurzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt "Santería in Deutschland. Manifestationen der afrokubanischen Religion in deutschen Kontexten" am Institut für Vergleichende Kulturforschung – Völkerkunde der Philipps-Universität Marburg.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008