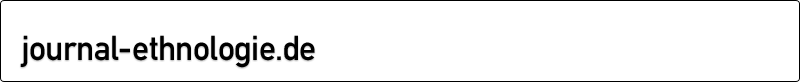
Eine deutsch-georgische Exkursion nach Chewsuretien und Kachetien
Von Godula Kosack
Mit einer Gruppe Ethnologie-StudentInnen nahm ich im Jahre 2001 an einer Exkursion der Universität Tbilisi teil. Die erste Etappe führte uns in das entlegene Gebiet der Chewsurer im hohen Kaukasus, das wir nur mit dem Hubschrauber erreichten. Über uns kreisten russische Hubschrauber; geschützt fühlten wir uns durch UNO-Friedenstruppen, die in demselben Ort stationiert waren, in dem wir in einer Schule kampierten. Kachetien, die in der Ebene gelegene Kornkammer und das Weingut Georgiens, in das wir anschließend reisten, konnte kaum einen stärkeren Kontrast bilden. Uns wurde veranschaulicht, dass Georgien ein Vielvölker- und Vielkulturenland ist.
Das Land der Chewsuren im Norden
Das in einer Bergsenke gelegene Kistani finden wir fast gänzlich verlassen vor. Eine einzige Familie siedelt hier noch das ganze Jahr über. Bis zu den Umsiedlungsmaßnahmen durch die Sowjetregierung in den zwischen 1950er- und 1960er-Jahren mag es noch sehr belebt gewesen sein. Von den Wohnfestungen auf dem schwer zugänglichen Bergkamm erfahren wir, dass sie noch bis in die 1920er Jahre bewohnt waren. Auf jeder Burg ist eine gespreizte Hand abgebildet, an der oberen Festung in Verbindung mit dem Lebensbaum. Die Hand bedeutet die segnende Hand des Familienoberhauptes, sie gilt dem Schutz der Familie in der Festung. Doch gegen den Zug der Modernisierung konnte auch dieses alt überlieferte Segenszeichen nichts ausrichten. Der Wohnturm auf der unserem Lagerplatz gegenüber liegenden Seite hatte einst aus 9 Stockwerken bestanden. Er war von neun Brüdern und ihren Familien bis in die 1970er-Jahre bewohnt. Als niemand mehr die Wartung übernahm, fiel er zusammen. Nach Schätzungen von Archäologen wurde das Haus bereits im 7. Jahrhundert errichtet.
Auf dem Platz, auf dem wir zelten, stand einst ein Dorf, das von Dagistanern und Legianern bewohnt worden war. Auch sie sind für immer verschwunden. Spurlos, denn wir konnten keine Häuserreste mehr ausmachen. Von den Wohnfestungen aus gesehen auf der anderen Seite des Berges stehen noch die Ruinen eines Dorfes namens Idsche aus dem 11. Jahrhundert. Es war von Chewsuren bewohnt, die im 11. oder 12. Jahrhundert das Volk der Legianer vernichteten.
An einem Julitag im Jahr 2001 füllt sich das Dorf Kistani wieder mit Leben um das Frühlingsfest atengenoba zu feiern. Dazu war eigens der sonst in der kachetischen Ebene lebende alte chuzessi , der Kultleiter, angereist. Die Bedeutung dieses Festes wurde dadurch erhöht, dass uns die Möglichkeit bewusst wurde, dieses Fest könnte in dieser Form zum letzten Mal stattfinden. Der Nachfolger eines chuzessi wird durch den Mund einer kadagi (Wahrsagerin) bestimmt, wenn diese einen entsprechenden Traum hat. Der als chuzessi Designierte bringt dem heiligen Hain, dem chadi , dem er zugeordnet ist, ein Rinderopfer und wird dann von dem alten chuzessi geweiht. Da es jedoch keine Wahrsagerin mehr gibt, wird es als Nachfolger des alten blinden Gabriel auch keinen neuen chuzessi mehr geben.
Die eigentliche Zeremonie fand auf dem chadi statt, den wir als Frauen nicht betreten durften. Ich hatte allerdings die Erlaubnis, bis kurz vor die Kulthäuser gehen und dort filmen zu dürfen. Erwirkt wurde dies durch den Hinweis darauf, dass ich bereits die Wechseljahre hinter mir hatte, denn die für moderne Menschen schwer zu begreifende „Unreinheit“ menstruierender Frauen ist damit hinfällig. Vielleicht wurde aber auch unser Interesse an den Zeremonien und Ritualen der Chewsuren geschätzt, und der chuzessi wollte den Weg für die Tradierung seiner Kultur ebnen.
Betont wurde immer wieder, dass sich die segnende Wirkung des mehrtägigen Frühlingsfestes auf die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Menschen, des Viehs und der Natur nur dann einstellen kann, wenn alle Regeln strikt eingehalten und alle Texte korrekt rezitiert würden. Von einem liturgischen Gesang des chuzessi begleitet, wurde das Opfertier der Kistani-Bewohner geschächtet. Dem chuzessi und seinen vier Festleitern chevisberi wurde ein Kreuz vom Blut des Opfertieres auf die Stirn gezeichnet. Am nächsten Tag beobachteten wir aus der Ferne, wie nach einem Gottesdienst in der Kapelle, die kein Kultfremder betreten darf, die drei heiligen Banner des chadi von Glockengeläut begleitet gehisst wurden. Der Segnung der Schwiegertöchter und der Nachkommen am dritten Festtag konnten wir aus Zeitgründen nicht mehr beiwohnen.
Ein zweiter Höhepunkt der Exkursion war die Teilnahme an dem dori , einem Teil des Totenkults in dem Dorf Chonigschala. Vierzig Tage nach dem Ableben eines Familienoberhauptes wurde ein Wettreiten der Männer veranstaltet, dem die Weihe des Rosses des Verstorbenen vorausgeht. Auf dem Hof wird eine tabla bereitet, die mit Wodka, Broten, Butter, Käse, Milch und verschiedenen Gerichten, allerdings kein Fleisch, gedeckt ist. Kerzen wurden angezündet und der chuzessi segnete die tabla . Er betete sinngemäß: „Gott wir loben dich und danken dir. Wir übergeben dir die Seele dieses Menschen. Hilf den Hinterbliebenen. Statt Kummer gib ihnen Freude. Lass alle Gäste, die hier versammelt sind, von heute ab nur noch zu fröhlichen Festen wiederkehren.“ Daraufhin tranken der chuzessi und die Männer auf das Wohl des Verstorbenen.
Nun wurde das gesattelte Pferd des Verstorbenen herangeführt, dessen Mähne und Stirn mit bunten Borten geschmückt waren. Am Sattel wurden Kerzen angezündet, und der chuzessi weihte dem Verstorbenen das Pferd: „Dieses Ross ist für dich allein bestimmt.“ Er goss etwas Wodka auf den Sattel und die Mähne und versetzte ihm drei leichte Peitschenhiebe. Die anwesenden Männer taten desgleichen. Das Pferd des Verstorbenen nahm nicht am Wettrennen teil. Fortan darf es nicht mehr zu schwerer Arbeit herangezogen werden, denn es gehört ja dem Verstorbenen.
Die Frauen hatten während dessen im Hause die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen auf seinem Bett ausgebreitet und klagten einzeln, jeweils das Portrait des Verstorbenen in der Hand haltend, um ihr Leid über den Verlust. Nachdem die Reiter – wir zählten sieben Teilnehmer – gestartet waren, wurde das Bett des Verstorbenen mit allen darauf befindlichen Gegenständen des Verstorbenen auf den Hof getragen und die Klage vor den Augen der Öffentlichkeit fortgesetzt. Zum anschließenden reichen Mahl waren alle eingeladen. Immer wieder wurde Wodka eingegossen, um des Verstorbenen zu gedenken.
In Ardothi, acht Kilometer von der beeindruckenden Festung Mutso entfernt, campten wir in der Nähe eines im Jahr 1992 von den Russen abgeschossenen tschetschenischen Hubschraubers, den wir als Esssaal benutzen. Hier im äußersten Winkel Georgiens, unmittelbar an der nördlichen Grenze gelegen, treffen wir dennoch mit Ausläufern der Moderne zusammen. Uns wurde berichtet, dass immer mehr Chewsuren, die in den siebziger Jahren durch die Sowjetregierung in die Ebenen zwangsumgesiedelt worden waren, nunmehr sich des Landes ihrer Vorfahren erinnern und zurückkehren, weil sich das Leben in der Ebene nicht als das bessere erwiesen hat. Denn den Menschen, die seit Generationen Vieh züchteten und das Land bebauten, wurde eine eigene Landwirtschaft in dem neuen Siedlungsgebiet untersagt.
Einer der Rückkehrer ist Niko Ardotheli (der Ardothianer), dessen Haus wir besuchten. Der 39-jährige hat in Tbilisi Philologie studiert und schreibt Gedichte, die auch veröffentlicht wurden. Zwar ist er selber in Kachetien geboren, doch stammte seine Familie aus Ardothi. Vor etwa acht Jahren kehrte Niko in das Dorf seiner Ahnen zurück. Neben der Burg baute er eine Ruine zu einem soliden Haus aus. Er heiratete eine Frau aus Mutso und hat drei Kinder mit ihr. Zurzeit ist er als Grenzsoldat tätig. Wie alle Männer hier bekommt er zwar Lohn, lebt aber in der Hauptsache von Viehwirtschaft. Niko gilt als Beispiel für Fortschritt: Er hat eine Wasserleitung vom Fluss in sein Haus gelegt und erhält von einer Solarplatte Strom für eine Glühbirne und ein Radio-Kassettengerät. Er setzt sich für den Fortschritt im gesamten Tal ein, das er als Landrat zu verwalten hat.
Chewuretien verließen wir voller Eindrücke von der noch scheinbar intakten Natur. Doch bei näherem Hinschauen wurden uns bald bedeutende Erosionsschäden deutlich. Unsere Wege säumten Geröllhalden, wo vor Jahren noch Kühe auf saftigen Weiden grasten. Es bleibt nur zu hoffen, dass die alten Kulturdenkmäler erhalten bleiben und nicht das Schicksal der Burgruine Katschu in der Nähe von Schatili erleiden, die - im 12. Jahrhundert vom Klan der Anatorianer erbaut und später von den Schatilianern besetzt - zum großen Teil in den Abgrund gestürzt ist.
Das Land der Kacheten im Osten
Der Kontrast der Landschaften konnte kaum größer sein. Die weite Ebene mit den üppigen Obstbäumen, Weinstöcken und Melonenfeldern wurden wir - wo immer wir anhielten - aufgefordert, einen Imbiss oder auch ein Mahl einzunehmen. Vor allem floss der Wein reichlich, ob in den großen kommerziellen Weinlagern oder in den Bauernhäusern. Entsprechend lernten wir auch die verschiedensten Weinsorten kennen, den berühmten Arascheni-Wein wie auch den einfachen Landwein. Noch heute wird im marani , den für Kachetien eigentümlichen Weinkeller, der nicht in die Tiefe des Bodens eingelassen, sondern ebenerdig zur Küche errichtet wird, der frisch gekelterte Wein in die in den Boden eingelassenen Tongefäße gefüllt. Ob in den Klöstern, in alten Bauernhäusern oder vor den Kirchen, überall sind diese „Bodenfässer“ zu finden, in denen der Wein bei Erdtemperatur sein Aroma entwickelt.
Der Wein hat für Kachetien nicht nur im Alltag Bedeutung, sondern auch eine rituelle Funktion: Der marani –Weinkeller wird nach kachetischer Tradition als erster Raum eines neuen Hauses gebaut. Das erste tönerne Bodenfass sedasche wird mit einem Ritual geweiht. Kerzen werden für das Glück und die Fruchtbarkeit der Familie angezündet. Von dem neuen Jahreswein wird dieser erste Topf zuallererst gefüllt. Bei der Hochzeit umschreitet die Braut ihn mit Kerzen. Vor einem Krieg wird von dem Wein aus dem ersten Topf geschöpft und mit einem Gebet getrunken. Wenn jemand um Unterstützung bei einem Problem wie einer Krankheit oder vor einer Geburt bittet, wird oft ein Weinopfer von eben diesem Wein versprochen. Dazu wird Wein in die Kirche gebracht und mit einem Hammel geopfert.
Der sedasche wird bei einem Umzug stets mitgenommen. Ein sedasche gehört immer zu der Familie, die ihn geweiht hat, auch wenn sie inzwischen ganz woanders wohnt. Die Familienangehörigen kehren anlässlich einer Geburt, ehe ein Sohn in die Armee einberufen wird und bei anderen familiären Ereignissen, zu einem solchen zurückgebliebenen sedasche zurück, um dort zu opfern und zu feiern. Dazu wird der sedasche gefüllt, ein Tisch wird gedeckt und ein festliches Mahl abgehalten. Lebt eine Schlange debiare (Natter) in dem sedasche , wird diese als Engel des Hauses betrachtet. Sie darf nicht berührt und schon gar nicht getötet werden. Das würde der Familie Unglück bringen.
Es kommt vor, dass ein sedasche in einer Kirche vergraben wird, sozusagen als die höchste Opfergabe. Die sedasche in der Kirche gehören der Kirche, sedasche außerhalb der Kirche gehören den Bewohnern, die dort bei Bedarf eine Opferzeremonie bringen. Die Kürze der Zeit erlaubte es uns nicht festzustellen, welche dieser traditionellen Handlungen noch gepflegt werden und welche der Vergangenheit angehören. Überzeugend wurde uns allerdings dargelegt, dass der Wein in Kachetien mehr als ein beliebiges alkoholisches Getränk ist. Wir erlebten es daher auch als Ehre, zur Weinlese im nächsten Jahr eingeladen worden zu sein.
Eindrucksvoll war es, auf dem Boden der antiken Akademie Iralto zu stehen, wo sich vor anderthalb Jahrtausenden die geistige Elite Europas versammelt hatte, um die junge Generation in ihr Wissen einzuweihen. Der von einer Mauer umgebene Komplex dehnte sich früher bis zu der einige Kilometer entfernt stehenden Eiche aus. Hier gab es zur Blütezeit Schulen für praktische Berufe in Bereichen wie Keramik, Imkerwesen, Schmiede, Wein- und Ackerbau. Daneben wurden in zehnjähriger Ausbildungszeit die Geisteswissenschaften Theologie, Philosophie, Physik, Medizin, Architektur, Mathematik, Literatur, Sprachen und Jura gelehrt.
Positiv hat mich berührt, dass seit dem 12. Jahrhundert hier auch Frauen zum Studium zugelassen waren, im Gegensatz zum antiken Griechenland und zu Europa bis ins 20. Jahrhundert hinein. Die Weltoffenheit der Akademie dokumentierte sich auch dadurch, dass zahlreiche Studierende und Lehrende aus dem Ausland kamen. Alte Schriften, zum Teil erst kürzlich wieder entdeckt, überdauerten die verschiedenen Zerstörungsversuche, so auch den durch die Perser im 18. Jahrhundert.
GeorgierInnen sind stolz auf ihre Vergangenheit und erzählen nostalgisch von der einstigen Größe des Reiches zu seiner Blütezeit unter ihrer Königin Tamara im 13. Jahrhundert. Dennoch versuchen sie so schnell wie möglich den Anschluss an das moderne Europa zu finden. Die Mischung aus Traditionsbewusstsein und Bereitschaft für das Neue macht die Faszination von Land und Leuten für uns aus.
Zur Autorin
Prof. Dr. Godula Kosack, 19 Jahre Lehrtätigkeit an der Fachhochschule Frankfurt, Fachbereich Sozialarbeit, Habilitation im Fachgebiet Völkerkunde an der Philipps-Universität Marburg. Seit 1981 Feldforschung bei den Mafa in Nordkamerun.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008









