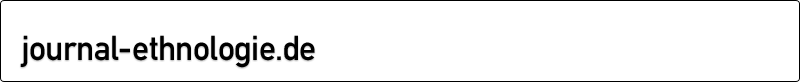
Urbane Traditionen in Kyoto
Von Christoph Brumann

Der Kilt, heute als uraltes schottisches Nationalsymbol angesehen, wurde in Wirklichkeit im 18. Jahrhundert von einem Engländer entworfen. Für die britischen Historiker Hobsbawn und Ranger ist dies ein Fall von „Erfindung von Tradition“ ( invention of tradition ), wie der Titel ihres bekannten Sammelbands von 1983 lautete. Der Sinn solcher Erfindungen ist es ihnen zufolge, kollektive Bindungen zu stärken und ganz und gar gegenwärtigen Interessen wie etwa der nationalen Identitätsstiftung zu dienen. So gut wie alle sozialwissenschaftlichen Analysen zum Umgang mit der Vergangenheit haben sich seitdem ebenfalls darauf konzentriert, solche Instrumentalisierungen von Traditionen und ihre Abweichungen von der tatsächlichen Geschichte aufzudecken. Tradition dient als konservatives Machtmittel, und ihre Inhalte werden so fast nebensächlich.
Diese Forschungsperspektive ist auch in Bezug auf Japan vielfach angewendet worden. In einer Gesellschaft, die seit dem späten 19. Jahrhundert eine besonders rasante Entwicklung hin zum modernen Nationalstaat vollzogen hat und entsprechende Symbole benötigte, liegt der strategische Gebrauch von Traditionen sicherlich nah. Und tatsächlich ist viel von dem, was heute als „traditionell japanisch“ gilt – etwa die shintoistische Hochzeitszeremonie, die lebenslange Anstellung in den Großfirmen oder die Abneigung gegen formale Rechtsstreitigkeiten – in Wirklichkeit jung, und Parallelfälle zum Kilt sind reichlich vorhanden.
Da liegt es nahe, Ähnliches auch in Kyoto zu vermuten, denn diese Stadt gilt dank ihrer mehr als tausendjährigen Vergangenheit als Kaisersitz und ihrer Verschonung im Zweiten Weltkrieg als historisches Zentrum des Landes. 1998/99 und 2001 habe ich hier in 19 Monaten ethnographischer Feldforschung zwei besonders gefeierte Traditionen untersucht. Die eine waren die historischen, ganz aus Holz gebauten Stadthäuser, die so genannten machiya , die seit Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr nur abgerissen, sondern zu Cafés, Restaurants, Galerien, Läden und modernen Wohnungen renoviert werden. Die andere Tradition war das Gion matsuri , das wohl berühmteste Fest Japans, bei dem nach tagelangen Aufbauarbeiten an jedem 17. Juli reich dekorierte Festwagen durch die Stadt gezogen werden. Aus der Perspektive der „Erfindung von Tradition“ könnte man erwarten, dass Lokal- und Nationalstolz sowie das Prestigestreben der Eigentümer und Traditionsträger hier die treibenden Kräfte sind, während die Traditionen selbst bloßes Mittel zum Zweck bleiben. Dies trifft jedoch nicht zu, hauptsächlich aus zwei Gründen.

Zum einen wird hier eine bestimmte Art von Tradition gesucht. In den herkömmlichen Beispielen von „Traditionserfindung“ geht es meist um abgeschlossene, gleichsam eingefrorene Traditionen - gerade die vermeintliche Unwandelbarkeit des Kilts symbolisiert die Unwandelbarkeit des Schottentums. Doch von machiya und Gion -Fest wird eher eine kontinuierliche Weiterentwicklung erwartet. Das originalgetreu restaurierte machiya -Stadthaus bringt Respekt ein, das Schlagwort der Bewegung aber ist „Wiederbelebung“ ( saisei ), und in die Zeitung gelangt man eher mit der Eröffnung eines Computerlabors oder eines Wellness-Centers im machiya .
Die baulichen Modernisierungen sind dabei nicht selten das eigentlich Interessante, wenn etwa alte Erdwände und abgewetzte Holzpfeiler mit blank polierten Stahlflächen und Halogenstrahlern kombiniert werden. Manchmal mischen sich die historischen Ebenen, wie in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, das mit Zeitungen aus den 1930er-Jahren tapeziert ist und in dem Secondhandartikel der 1960er- und 70er-Jahre verkauft werden. All diese Zeitphasen können bei heutigen Japanern Nostalgie auslösen, haben aber sonst wenig miteinander zu tun, und das Café im ehemaligen Garten wird im Kontrast dazu von einem modernen Glasdach überspannt. Dass dies dem Besucher auffällt, ist durchaus gewollt.
Auch beim Gebrauch der Häuser sehen zwar viele Erhaltungsaktivisten die Wohnnutzung der Vergangenheit als ideal an, faktisch dominieren aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die Cafés, Restaurants und Läden. Die Medien berichten am liebsten über Initiativen wie die der jungen Künstler im alten Weberviertel Nishijin, die leer stehende machiya mit wenig Geld renovieren und in SoHo-Manier als Wohnateliers nutzen. Kreativität ist im Umgang mit der Vergangenheit also gefragt.
Beim Gion -Fest liegt der Fall etwas anders. Dieser eigentlich religiös motivierte Ritus ist seit dem Krieg zu einem staatlich anerkannten und finanziell geförderten Kulturerbe erhoben worden und zieht als intensiv beworbene Touristenattraktion Hunderttausende von Besuchern an. Dies bedingt eine stärkere Verpflichtung zur Bewahrung der historischen Formen, und so spricht hier niemand von der Wiederbelebung der Wagen, Kostüme oder Festmusik.

Dennoch wurde mir während des Festzyklus in einer der teilnehmenden Nachbarschaften deutlich, dass auch hier keine erstarrte Tradition gesucht wird. Die Teilnehmer betonten vielmehr, wie sehr das Fest für sie nicht nur historisches Erbe, sondern nach wie vor auch Ritus und vor allem ein großer Spaß ist. Auch haben sie sich erfolgreich gegen eine Musealisierung gewehrt. Die antiken, schon früher aus aller Welt importierten Gobelins und Webteppiche, mit denen man die Festwagen seit Jahrhunderten behängt, sind irgendwann verschlissen und müssen ersetzt werden. Doch die dafür von den staatlichen Denkmalschützern favorisierten Repliken, die das historische Aussehen bewahren, passen in den Augen meiner Informanten nicht zum Rang des Festes. Sie ziehen vielmehr neuerliche Importe oder originale Kreationen vor und haben diese Position auch gegenüber den Denkmalschützern durchgesetzt.
Bei alledem ist es weniger das pure Alter als vielmehr die Kontinuität des Festes, die die gegenwärtigen Teilnehmer fasziniert. Immer wieder hörte ich, wie sehr es Ehre und Verpflichtung ist, selbst ein Glied in einer über 600 Jahre zurückreichenden Kette der Weitergabe zu sein. Dagegen war das akademisch-historische Wissen über das Fest und die Ausstattungsstücke weit weniger ausgeprägt.
Es ist also eine mit der Gegenwart verbundene und in die Zukunft weisende Tradition, die geschätzt wird, und dies nicht in erster Linie wegen ihres symbolischen und gemeinschaftsstiftenden Wertes. Per Fragebogen erkundigte ich mich bei den Mitgliedern einer besonders rührigen machiya -Erhaltungsinitiative, welches ihre Gründe sind, die Häuser erhalten zu wollen. Zwar war für eine Mehrheit die Tatsache, dass die machiya für Kyoto und ganz Japan stehen, ein Erhaltungsmotiv. Die am häufigsten gewählten Gründe waren aber andere. Einerseits solche, die die Naturnähe der Häuser betonen – das hölzerne Baumaterial, die Spürbarkeit der Jahreszeiten, die Gärten im Inneren und die Umweltfreundlichkeit –, und andererseits solche, die die harmonisierende Wirkung der Häuser herausstellen – ihre Schönheit, ihre Harmonie mit dem Kyotoer Stadtbild, ihre gute Atmosphäre und ihre beruhigende Wirkung.
Dies alles sind konkret erfahrbare Qualitäten, die überdies nicht an das Baujahr und den sozialen Kontext der Häuser gebunden sind. Und während die Traditionalität der Häuser zu den wichtigsten Motiven zählt, ist ihr bloßes Alter nur für eine Minderheit ein Grund für ihre Erhaltung. Im Gegensatz zu den machiya steht zwar das Gion -Fest unter dem besonderen Schutz des japanischen Staates, aber auch hier habe ich selten nationale Töne gehört, und ausländische Helfer beim Ziehen der Festwagen sind mittlerweile genauso verbreitet wie ausländische Teppiche.

Auch zur Wahrung elitärer Privilegien innerhalb Kyotos haben die untersuchten Traditionen nicht beigetragen, eher im Gegenteil. Der machiya -Restaurierungsboom ermöglicht es nun selbst dem bescheidensten Haus, ins Rampenlicht zu treten, und bezieht sich insgesamt auf gewöhnliche Wohnhäuser, nicht auf Elitearchitektur. Zudem bilden die Eigentümer der prächtigeren Häuser keinen exklusiven Zirkel und dominieren nicht den öffentlichen Diskurs.
Die öffentlichen Zuschüsse zum Gion -Fest haben die Statusordnung innerhalb der teilnehmenden Nachbarschaften ebenfalls aufgebrochen. Die Unterschiede zwischen den früher als Sponsoren auftretenden Grundeigentümern und den Mietern sind dadurch so gut wie verschwunden. Im Jahr 2001 demokratisierte sich der gesamte Festzug auf ungeahnte Weise, als herauskam, dass unter den Musikern auf einem der Festwagen in den vergangenen Jahren heimlich einige junge Mädchen gewesen waren. Zwar war dies ein Verstoß gegen das Verbot der Teilnahme des vom shintoistischen Standpunkt aus unreinen Geschlechts am Fest. Doch gelang es weder dem zentralen Festkomitee noch den staatlichen Stellen, die betroffene Nachbarschaft zu disziplinieren, zumal diese die öffentliche Meinung auf ihrer Seite hatte. Schließlich wurde die Teilnahme von Frauen allgemein zugelassen. Hinter der Renitenz der Nachbarschaft verbarg sich zwar eher eine Revolte der Festmusiker gegen ihren untergeordneten Status als wirklich der Wunsch nach Gleichstellung der Geschlechter, aber auch das ist ein Abbau alter Rangunterschiede. Traditionen sind also in Kyoto nicht das Instrument der sozialen Ausgrenzung, als das die "Erfindungs"-Perspektive sie so gerne sieht.
Teilweise liegt dies an einigen Besonderheiten. Zum einen haben die machiya -Stadthäuser und das Gion -Fest eine lange, gut dokumentierte und damit respektable Geschichte, die der Schönung kaum bedarf. Zum Zweiten werden sie trotz aller Touristen hauptsächlich von Einheimischen getragen und richten sich zuvorderst an ein Kyotoer Publikum. Dies ist anders als in den vielen Fällen, in denen Außenseiter die Propagierung japanischer Traditionen übernommen haben, und wenn etwa städtische Intellektuelle in bäuerlichen Sitten und Bräuchen eine ursprüngliche Reinheit wiederzufinden meinen, ist die Gefahr weit größer, dass Realität und Fantasie auseinander klaffen. Zum Dritten stehen die Kyotoer Traditionen außerhalb der etablierten Kategorien: Die machiya -Stadthäuser und das Gion -Fest sind Teil der Kultur der gewöhnlichen Handwerker und Kaufleute und nicht der in Kyoto ehemals reichlich vorhandenen Adels-, Krieger- und Priestereliten. Trotzdem sind sie – eben weil es sich um das historisch wichtigste urbane Zentrum handelt – von Eleganz, Raffinesse und Eklektizismus geprägt, also von für so genannte "Volkskultur" ungewöhnlichen Merkmalen. Für die auf den Festwagen mit Puppen dargestellten Szenen wurde etwa im 15. und 16. Jahrhundert der Mythen- und Historienfundus ganz Ostasiens ausgebeutet, ähnlich wie es in der damaligen europäischen Kunst mit der antiken Mythenwelt geschah. Und auch die Gobelins und Webteppiche von Flandern bis China erschweren es, sich hier den zeitlosen Urgründen eines „wahren Japan“ nahe zu fühlen.
Wo diese Besonderheiten nicht vorliegen, führt die Idee der „Erfindung" von Tradition sicherlich auch in Japan weiter. Aber auch dort tut man den Traditionen unrecht, wenn man sie auf einen gesellschaftlichen Klebstoff reduziert, ohne sich mit den persönlichen Motiven und Deutungen ihrer Träger zu befassen. Der Ethnologe Marshall Sahlins betont, dass es gerade die Vitalität erfolgreicher Traditionen sein kann, die ihre Träger zu kreativen Adaptionen motiviert. Traditionen müssen ihm zufolge nicht bloß „erfunden“ ( invented ), sondern können auch „erfinderisch“ ( inventive ) sein, das heißt die kulturelle Innovationsfreude herausfordern. Der Umgang der Kyotoer mit ihren Traditionen gibt ihm Recht.
Weiterführende Literatur
Brumann, Christoph (2001): Machiya vs. manshon: Notizen vom Kyotoer Häuserkampf. Japanstudien 13:153-192
Brumann, Christoph (2005): A Right to the Past: Tradition, Democracy, and the Townscape in Contemporary Kyoto. Unveröffentlichte Habilitationsschrift, Universität zu Köln
Hobsbawm, Eric; Terence Ranger (eds.) (1983): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press
Sahlins, Marshall (1999): Two or Three Things That I Know About Culture. Journal of the Royal Anthropological Institute 5:399-421
Zum Autor
Christoph Brumann hat in Köln und Tokio Ethnologie, Japanologie und Sinologie studiert und ist wissenschaftlicher Assistent am Institut für Völkerkunde der Universität zu Köln, wo er sich 2005 habilitiert hat.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008