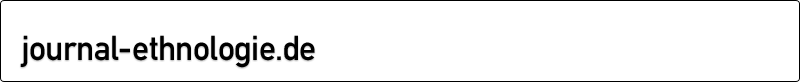
Zur Kultur des Computerspielens
Von Mark Butler
Die Diskussion für und wieder Computerspiele reißt nicht ab. Dabei zeigt sich, dass ein großer Teil derer, die darüber reden, keine oder kaum Erfahrungen mit Computerspielen haben. Um mehr von der Kultur des Computerspielens zu erfahren, habe ich ausgehend von meinen eigenen Erfahrungen eine ethnographische Studie durchgeführt und acht Spieler befragt, die zwischen 11- und 32-Jahre alt waren, männlich wie weiblich, Langzeitspieler und Spielanfänger.
Gerade diese letzte Unterscheidung hat sich als sehr interessant herausgestellt. Die Erfahrungsberichte von den Spielneulingen wiesen eine größere „Frische“ auf als die der erfahrenen Spieler. Wie zum Beispiel die Erzählung der LARA K, eine 28-jährige Germanistikstudentin, die ich nach ihrer Affinität für Lara Croft, der Protagonistin von "Tomb Raider" benannt habe. Sie hat sich über ihre eigene Ergriffenheit durch das Spiel gewundert: „Ich habe gemerkt, dass ich mich noch gar nicht damit auseinander gesetzt habe, dass es nur ein Computerspiel ist. Indem mein Herz angefangen hat zu rasen, wenn ein Tyrannosaurus Rex plötzlich vor mir stand – dass ich mich bedroht gefühlt habe, nicht sie ... Das fand ich echt erstaunlich!“
Alle Spieler berichteten von dem Reiz, der von der Möglichkeit ausging in eine virtuelle Identität zu schlüpfen und in ein digitales Rollenspiel des "Als-Ob" zu treten. Während LARA K sich wünschte „auch so eine starke Frau zu sein“ wie Lara Croft, haben andere Spieler andere Affinitäten gezeigt. So zum Beispiel CAINEBRAIN, ein 32-jähriger Maler und Multimediakünstler, der noch bevor "Diablo 2" herauskam, wusste, dass er den Totenbeschwörer spielen würde – was er mit seiner jugendlichen Begeisterung für Geistergeschichten begründete.
Wie mit LARA Ks Schilderung angedeutet wird, phantasieren sich Spieler aktiv in die Spielwelt hinein. Ihre psychologische Präsenz wird in die fiktive Welt hineinverlagert, ein Phänomen, das Immersion genannt wird und auch beim Lesen eines Romans auftritt. Spieler betreten buchstäblich die digitale Illusion. In intensiven Spielphasen sind sie „in lusio“, im Spiel auf der anderen Seite des Bildschirms. Im Gegensatz zum Lesen eines Romans sind Computerspiele aber bekanntlich interaktive Medien. Die unterschiedlichen Identitäten bilden sich nicht nur aus den Erscheinungsweisen und zugeschriebenen Charakterzügen der Spielfiguren, sondern vor allem aus der Menge der angebotenen Interaktionsmöglichkeiten. So berichtete LT. LUNTE, ein 28-jähriger Netzwerkadministrator, vom Unterschied zwischen dem Spielen eines Vampirs und dem eines Vampirjägers in „Vampire Slayer“. Während letztere sich relativ behäbig zu Fuß durch die Spielwelt bewegen und über Fernwaffen verfügen, müssen die Vampire aus der Nähe angreifen, sind dafür blitzschnell, können über große Distanzen springen und schadlos von Dächern herunter gleiten. „Sie können unmögliche Wege gehen. Deswegen kommt man meist durchs Fenster anstatt durch die Tür.“ Die Spielidentität ist direkt in die virtuelle Verkörperung hineinprogrammiert in Form der gegebenen Handlungsmöglichkeiten.
Das Eintauchen in ein Computerspiel setzt einen Lernprozess voraus. Der Spieler muss sich in die Möglichkeiten seiner virtuellen Verkörperung einüben. Er hat je nach Spiel eine virtuelle Optik, Akustik, Haptik, Gestik und Kinästhetik. Spieler, die die Steuerung eines Spiels erfolgreich gemeistert haben, erweitern ihr Körperschema um ihre digitale Inkarnation. In den intensivsten Spielphasen löst sich ihre Selbstreflexivität auf und sie geraten in einen Spielfluss, in dem ihr Denken und Handeln miteinander verschmelzen. Dieser Zustand des Flusses ist bekanntlich einer der erfreulichsten Zustände, den Menschen erleben können und ist ein zentraler Reiz des Computerspielens.
Im Verlauf einer Computerspielsitzung bilden Spieler und Computer eine kybernetische Einheit, kurz Cyborg, indem sie an denselben Informationskreisläufen partizipieren. Entlang mehrerer Rückkopplungskanäle werden symbolische Botschaften ausgetauscht. Das ist die Grundlage der digitalen Interaktivität. Spieler müssen die Strukturen des Programms internalisieren, um erfolgreich am Spiel teilzunehmen. Dieser Austausch, sowie das damit einhergehende identifikatorische Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur, gehen mit einer affektiven Kopplung einher. Die Schnittstelle – die aus Bildschirm, Lautsprecher und Kontroller sowie die darunter liegenden Rechenprozessen besteht - tritt in den Hintergrund und verbindet den empfindsamen Körper vor dem Bildschirm mit dem Datenkörper in der virtuellen Welt.
Die ergreifendsten Zustände, von denen meine Interviewpartner berichtet haben, sind die der Angst. Wenn sie in ein Computerspiel versunken und in einen Spielfluss geraten sind, kann eine existentielle Bedrohung in der virtuellen Welt physische Reaktionen auslösen. Wie LARA K berichtete auch DEEP 6, eine 26-jährige Ethnologin, die ich nach ihrer Immersionslust benannt habe, davon. Bestimmte Spiele kann sie nicht alleine im Dunkeln spielen, weil sie zuviel Angst bei ihr auslösen. Trotzdem findet sie gefallen an diesen Spielen. Etwa "Doom 2", ein Spiel, an das sie sich "rantasten musste“. Als sie sich daran gewöhnt hatte, konnte sie es „immer wieder spielen, (...) das hat so einen Spaß gemacht!“. Dieser Nervenkitzel ist vergleichbar mit der intensiven Lebendigkeit, die Menschen bei Achterbahnfahrten genießen.
Neben der Atmosphäre der Angst sind mir viele weitere Gefühlsräume begegnet. Überhaupt lässt sich die virtuelle Realität als ein Laboratorium des Vorstell- und Fühlbaren charakterisieren. Eine provisorische Liste der affektiven Zustände, die Computerspiele herbeiführen können, umfasst: Neugierde, Experimentier- und Schaffensfreude, Wahrnehmungslust, Heiterkeit, Habgier, Aggression, Tobsucht, Größenwahn, Eroberungslust, Eifer, Ordnungswut, Stress, Angstzustände von Klaustrophobie bis Panik, Melancholie, Sehnsucht, Mut, Fürsorge, Mitleid, Geborgenheit und Ruhe.
Während alle Spieler Spuren dieser intensiven Erlebnisse bezeugten, unterschieden sich die Langzeitspieler dadurch, dass ihre Berichte eine größere Kühle und Distanz zu diesen Spielerlebnissen aufwiesen. An einigen Stellen klang zwar immer noch die Intensität ihres In-Der-Virtuellen-Welt-Seins an, aber sie verfügten über elaborierte Kodes um ihre Erfahrungen mitzuteilen und zu verarbeiten. Sie sprachen eher über Spielstrukturen, gelungene und misslungene Spielmechaniken, die Art und Weise in der Spiele inszeniert wurden und stellten Vergleiche zwischen verschiedenen Spielen an. Sie unterschieden zwischen den jeweiligen Reizen der Spiele, was mit der Unterscheidung des Medientheoretikers Claus Pias zwischen zeitkritischen Actionspielen, entscheidungskritischen Adventurespielen und konfigurationskritischen Strategiespielen vergleichbar ist. So ist LT. LUNTE begeisterter Anhänger der Echtzeitspiele - „Actionspiele trainieren auf jeden Fall das Reaktionsvermögen!“ - während andere Spieler sie zu stressig finden. LARA K dagegen betonte die Adventurespieldimension des Action-Adventures „Tomb Raider“: „Der Reiz besteht darin, neue Sachen zu entdecken, eben dieses Entdecken – es wird wirklich der Forscherinstinkt wachgerufen.“ Andere Spieler bevorzugen die Strategiespiele, in denen der charakteristische Reiz im Experimentieren mit einem vier-dimensionalen Modell aus einer quasi allmächtigen Position liegt. CAESAR, ein 30-Jähriger Physiker, begründete seine Vorliebe für diese Spiele mit den Worten: „Du bist einfach souverän“.
Die Spieler berichteten von unterschiedlichen Beweggründen, weswegen sie in verschiedenen Situationen zu einem Computerspiel griffen. An erster Stelle wird ihre vergnügliche Qualität betont. „Es macht Spaß, also macht man’s“, so der 15-jährige #NONE, selbstbewusster Vertreter der neuen Mediengeneration. Des Weiteren sprachen die Spieler von Entspannung, Vertreibung von Langeweile, Ablenkung von Problemen und Unzufriedenheit, Flucht in eine letztendlich überschaubare und handhabbare Welt, Abbau von Stress und Wut, dem Wunsch, eine Erfahrungswelt mit Freunden und Verwandten zu teilen und nicht zuletzt von der Faszination an den virtuellen Möglichkeiten.
Alle Spieler kannten den Sog der Spiele, der am größten bei neuen ist, und die meisten berichteten von ihrem großen Suchtpotential. Das ist auch insofern sehr nachvollziehbar, als dass kaum eine andere Tätigkeit eine so hohe Dichte an Erfolgserlebnissen anbietet. Spieler können den Schwierigkeitsgrad der Spiele justieren, um so in einen optimalen Spielfluss zu gelangen, der weder zu einfach und somit langweilig, noch zu schwierig und somit frustrierend ist. Wenn man den Umgang mit Computerspielen problematisieren will, dann ist der Befund, dass die Spiele immer mehr Zeit und Energie verschlingen, sowohl Libido als auch Elektrizität, weitaus wichtiger als ihre vermeintliche Gewalt erzeugende Wirkung.
Man muss aber an dieser Stelle anmerken, dass alle von mir interviewten Spieler Strategien entwickelt haben, um mit dem Sog der Spiele umzugehen. Diese reichten von der Verbannung sämtlicher Spiele von der Festplatte bis hin zur zeitlichen Reglementierung ihres Spielverhaltens. Letzteres geschah sowohl selbst- als auch fremdbestimmt, wie im Fall der 11-Jährigen SYM, die ihre Hausaufgaben erledigen musste bevor sie "The Sims" spielen durfte.
Die ethnographische Perspektive auf das Computerspielen ist hilfreich in Bezug auf die gegenwärtige Diskussion. Viele Kritiker sehen eine Gefahr darin, dass Spieler aufgrund ihres häufigen Aufenthalts im virtuellen Raum die reale Welt zunehmend verkennen. Diese Gefahr ist zwar ernst zu nehmen und kommt durchaus zum Tragen – zum Beispiel bei der Steuerung von Predatordronen mit einem Gamepad im gegenwärtigen Irakkrieg (wenn, dann macht hier die Rede von "Killerspielen" Sinn). Während die Gefahr der Verwechslung der virtuellen mit der nicht-virtuellen Welt gesamtkulturell gesehen durchaus ernst zu nehmen ist, hat meine mikroskopische Feldforschung aber gezeigt, dass durchschnittliche Spieler sehr wohl diese Unterscheidung treffen können. Sie tauchen zwar regelmäßig in die virtuell-imaginäre Illusionen ein, das ist ja die Bedingung des Spielspaßes, aber sie kehren auch immer wieder in ihren realen Leib zurück. Dann machen die Rücken- und Muskelschmerzen auf ihren immobilen, die immergleichen Bewegungen vollziehenden Körper aufmerksam. Die Spieler werden sich ihrem verdrängten Hunger und Durst, sowie der verstrichenen Zeit bewusst und reflektieren das, was sie soeben leidenschaftlich getan haben. Während sie einerseits Spielstrukturen durchaus auf die nicht-virtuelle Welt übertragen, wissen sie andererseits um diese Entgrenzungsphänomene und um die Konstruiertheit dieser Zusammenhänge. So berichten mehrere Spieler von „Sim City“, dass sie durch das Spiel städteplanerische Maßnahmen besser verstünden, beklagten sich aber zugleich, dass das Programm nur bestimmte Entwicklungsverläufe zulässt und andere ausspart.
Das Computerspielen ist eine gebrochene Erfahrung, was sich auch in den zwei Arten von Berichten (von Langzeitspielern und Spielanfängern) niederschlägt, die hier skizziert wurden. Während in den intensiven Erlebnisberichten von den virtuell-imaginären Illusionen des Computerspielens gesprochen wird, wird bei den reflexiven Berichten erfahrener Spieler auf die Zusammensetzung des Programms rekurriert. Hier werden die Spiele als symbolische Fiktionen beschrieben, digitale Konstrukte, die auch anders hätten entworfen werden können.
Die Unterscheidung zwischen der imaginären Illusion und der symbolischen Fiktion ist wichtig um den überhitzten Diskurs über Computerspiele zu verstehen. Die meisten derjenigen, die über die Spiele in den Medien urteilen, haben nur rudimentäre Spielerfahrungen. Wie LARA K sind sie erstaunt über die intensiven Erlebnisse die Computerspiele bieten. Im Gegensatz zu den meisten Computerspielern, haben sie weder die Zeit und noch die Energie investiert, um einen Umgang mit den Spielen zu entwickeln. Wie bei anderen Medien, so lautet ein zentrales Ergebnis meiner Untersuchung, erzeugt die Nutzung der Computerspiele auch mediale Kompetenz.
Weiterführende Literatur
Adamowsky, Natascha (2000): Spielfiguren in virtuellen Welten. Frankfurt am Main
Butler, Mark (2007): Would You Like to Play a Game? Die Kultur des Computerspielens. Berlin
Butler, Mark (2007): Zur Performativität des Computerspielens. Erfahrende Beobachtung beim digitalen Nervenkitzel. In: Holtorf, Christian und Pias, Claus (Hg.): Escape! Computerspiele als Kulturtechnik. Weimar, Wien
Pias, Claus (2002): Computer Spiel Welten. München
Zum Autor
Mark Butler, Studium der Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Humboldt Universität, Berlin. Zurzeit promoviert er am kulturwissenschaftlichen Institut der Humboldt Universität über populäre Techniken des Selbst. Forschungsschwerpunkte: Umgang mit Technik und Medien/Populäre Kultur.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008