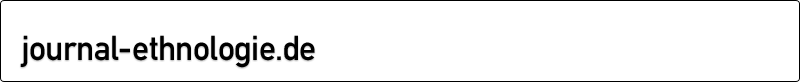
...und was danach geschah an der Küste Südost-Indiens
Von Hilde K. Link

Am Sonntagmorgen spielen die Kinder von Chinnamudaliyarchavadi, das ist ein kleines Fischerdorf etwa sieben Kilometer nördlich von Pondicherry, immer Kricket am Strand. Das haben sie auch am 26. Dezember 2004 getan.
Plötzlich war sie die da, die Welle. Wie ein Wesen, das die Kricket-Kinder vor sich hertrieb, als wollte es mit ihnen Fangen spielen. Die Kinder wollten sich aber nicht fangen lassen und schrien und liefen weg. Das Wesen wurde wütend, fing an zu toben und verfolgte sie, bis es die Jungen an den Fersen erwischte und sie hinfielen. Das war kurz vor der Mauer des Hauses, in dem ich wohne, wenn ich in Indien arbeite. Die Kricket-Jungen lagen im Sand, und als ob ihm das Fangen-Spiel langweilig geworden wäre, blieb das Wasser einfach stehen. Die Kinder rappelten sich hoch und liefen zur Straße.
Das Verschlingerwesen
Für die Fischer ist das Meer nicht einfach nur Wasser. Es ist ein Verschlingerwesen, mit dem man vorsichtig umgehen und das man mit Ritualen versöhnlich stimmen muss. Irgendwo an der Küste, wer weiß, vielleicht in Nagapattinam, da, wo das Ungeheuer am stärksten gewütet hat, wurden die Rituale nicht entsprechend durchgeführt. So sagen die Fischer. Sonst wäre das nicht passiert.
Als ich das Wasser sah, wie es sich über das Land schob, von der Sonne in eine silberne Platte verwandelt, da packte ich meinen Computer und rief durchs Haus: „Weg! Weg! Die Flut kommt!“ Dann sind wir zum Auto. Außer meinem Mann und meinem zehnjährigen Kind passten noch die sechs Tamil-Frauen und deren sieben Kinder, die sich gerade im Haus befunden hatten, in mein Auto. Der Vater, Großvater, Ehemann, Schwager, Onkel von all den Frauen und Kindern, Raman, lief zum Gartentor und öffnete es, sodass ich zügig hinausfahren konnte. Ich wartete, damit er zusteigen sollte. Mit gesammelter Miene schritt er zur offenen Autotüre. Die Frauen kreischten hysterisch:„Komm! Komm! Steig ein!“
Das Familienoberhaupt verkündete mit fester Stimme: „Wenn es mein Karma ist, von den Wellen verschlungen zu werden, dann werde ich dieses annehmen!“ Ich versuchte zu argumentieren, dass sein Karma auch darin bestehen könnte, jetzt sofort und ganz schnell einzusteigen und dadurch der Flut zu entkommen. „Gott wird mich retten, wenn er das will!“, entgegnete er. Kaum hatte er das gesagt, riefen die Frauen nicht mehr „Komm!“ zu Raman, sondern „Fahr los! Lass ihn zurück!“ zu mir.
Oben auf dem Hügel dann stand eine Gruppe von etwa 30 Männern mit Schlagstöcken. Jeden Weißen, der keine Tamilen im Auto hatte, zogen sie aus dem Wagen und verprügelten ihn, das Auto wurde demoliert. Mich ließen sie mit meiner Fracht passieren und winkten freundlich.
Die Nacht haben wir Frauen mit unseren Kindern bei einer verwandten Tamil-Familie auf Reisstrohmatten zugebracht. Mein Mann ist zurück zum Haus. Als wir am nächsten Tag wieder gekommen sind, hatte das Verschlingerwesen im Fischerdorf nebenan alles mitgerissen, was es bekommen konnte: Boote, Netze, Hütten, Kleider, Kochgeschirr, einfach alles. Ein behindertes Mädchen kam ums Leben, weil es nicht schnell genug weglaufen konnte. Mehr als 200 Kinder und deren Familien in Chinnamudaliyarchavadi sind jetzt obdachlos – verglichen mit dem, was weiter südlich geschehen ist, geradezu harmlos. Getroffen hat es die Ärmsten der Armen, diejenigen, die direkt am Wasser gewohnt haben.
Ramans gnädiger Gott hat ihn gerettet und unser Haus gleich mit. Das hätten wir den religiösen Zeremonien zu verdanken, die er vollzogen hätte, als wir weg waren, erklärte er.
Nachdem das Wesen satt war, hat es sich wieder beruhigt. Einigermaßen jedenfalls. Noch lange atmete es schwer von seiner Anstrengung, denn es hatte weiter unten im Süden viele Menschen verschlungen, die es bis zum heutigen Tage, drei Wochen nach der Tragödie, hier bei uns wieder ausspuckt, von Fischen angefressen. Die Strömung geht hier am Golf von Bengalen von Süden nach Norden. Inzwischen sind es nur noch einzelne Körperteile, die angeschwemmt werden. Die Fischer gehen ständig den Strand ab, um den Hunden zuvorzukommen. Die Leichen werden mit Stricken am Ufer entlanggezogen und dann in einem Massengrab beigesetzt.
Von der Schwierigkeit zu helfen
ZDF-Reporter, die mich hier in Indien besucht haben, erzählten, das Essen würde in der Nähe von Chennai auf der Straße herumliegen und die Hunde würden es fressen. Hier bei uns, im Süden, da ist das anders. Als meine Helfer für die Fischer 1200 Pakete gekochtes Essen ausliefern wollten, wurden sie von den Bewohnern des Dorfes, durch das sie mit ihrem Wagen fahren mussten, mit Steinen beworfen. Die Dörfler (die Goundar) an der Straße und die Fischer gehören jeweils anderen Kasten an und sind sich spinnefeind. Die Dörfler riefen: „Wir haben auch Hunger!“, rissen so viele Pakete vom Wagen, wie sie erwischen konnten, und reichten sie ihren Frauen und Kindern weiter. Zum Glück war die Spende angemeldet. So sorgte die Polizei sofort für Ruhe, die Fracht wurde ins Fischerdorf eskortiert und dort verteilt, wo sie hingelangen sollte.
Die indische Regierung handelte organisiert und prompt. Kurz nach dem Tsunami traf ein LKW mit Notunterkünften ein. Die Helfer wollten in einem Palmenhain jenseits der großen Küstenstraße für die Fischer ein Notlager errichten. Der Palmenhain ist zwar offiziell Regierungsgelände, die Dörfler aber hatten die Palmen gepflanzt. Als das Material abgeladen war, formierten sich die Goundar zu Schlägertrupps. Die Beamten packten alles wieder ein und zogen unverrichteter Dinge ab. Die obdachlosen Fischer schlafen jetzt unter Bäumen oder bei Leuten in ihrem Dorf, deren Hütten verschont geblieben sind. Inzwischen führen die Goundar organisierte Überfälle auf Tsunami-Transporter mit Hilfsgütern aus.
Einige Fischer kamen zu mir und baten mich um schnelle Hilfe. Sie sagten mir, was sie dringend bräuchten: Erst einmal gekochtes Essen, 1000 kg Reis, Decken, Handtücher. Aber auch Kleider und Schulhefte, denn die Direktorin der Fischer–Schule versucht, einen einigermaßen normalen Unterricht hinzubekommen, sodass die Kinder wenigstens einen Ort haben, an dem alles so ist, wie es einmal war.
Mein spontanes Angebot an die Fischer, ich könne doch die zusammengebrochenen Hütten mit Spendengeldern in einer Aktion von ein paar Tagen wieder aufbauen lassen, traf bei den Betroffenen, vor allem bei den Frauen, auf blankes Entsetzen. Keine zehn Pferde brächten sie und ihre Kinder wieder an den alten Platz zurück. Zugegeben, einfach an die alte Stelle neue Hütten hinzustellen, war eine Idee, die spontan aus meiner eigenen Betroffenheit geboren war.
Die Regierung hat beschlossen, dass im gesamten Küstenbereich keine Behausung, nicht einmal ein Schattendach, näher als 500 Meter am Meer stehen darf. Die Fischer dürfen dann nur noch zum Arbeiten an den Strand gehen. Das bedeutet, für die Umsiedlungspolitik muss neues Land gefunden werden. In der Nähe von Chinnamudaliyarchavadi war das nicht einfach, weil die Gegend so dicht besiedelt ist. Die Fischer leben dicht an dicht mit den Feldbauern und den Dalit (das sind die so genannten Unterdrückten, die Kastenlosen). So konnten hier nicht einfach irgendwo Notunterkünfte für Fischer vom Strand aufgestellt werden.
In früheren Zeiten haben die Fischer ihre Hütten einfach am Meer aufgestellt, ohne zu fragen, wem das Land offiziell gehört. „Alles Land gehört dem höchsten Herrn“, ganz einfach. Das war bisher auch kein Problem. Jetzt ist eine Katastrophe passiert, und weil das Land nicht nur Gott, sondern auch dem indischen Staat gehört, ist dieser, der indische Staat, auch zuständig für die Leute, die sich auf diesem Land aufgehalten haben und sich immer noch aufhalten. Künftig will die Regierung diese Verantwortung an die Menschen selbst weitergeben, indem sie jeder einzelnen Fischerfamilie Land zuweist und diese Parzelle offiziell auf deren Namen in das Grundbuch eintragen lässt. Das bedeutet, dass künftig den Fischern Landrechte zugewiesen werden, die sie vorher nicht hatten. Auf jeder Parzelle wird auch eine vorläufige Behausung für jede einzelne Familie errichtet werden. ‚Vorläufig’ heißt, dass der neue Eigentümer künftig im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen sein Haus erweitern, aufstocken oder verändern darf. Auch darf er das eigene Stück Land gestalten, also beispielsweise einen Garten anlegen oder eine Kuh darauf stellen, was vor allem für die Fischerfrauen neue Erwerbsquellen auftun wird.
So mancher ungeduldige Spender, der speziell für den Aufbau von Hütten Geld gegeben hat, muss wissen, dass es sich bei den ‚Hütten’ für die Fischer, die die Regierung baut, um Wellblech- und Wellplastikverschläge handelt, die sich im Sommer zu unbewohnbaren Backöfen verwandeln werden. Die Regierung hat mit dem Bau dieser Behausungen schon begonnen. Sobald die Einträge im Grundbuchamt bestätigt sind, werde ich dafür sorgen, dass die ‚vorläufigen Hütten’ in menschenwürdige Wohnstätten verändert werden.
Was Boote und Netze anbelangt, zeigte sich die Regierung auch da zunächst zurückhaltend. Abgesehen davon, dass die Fischer wegen der Leichen sowieso nicht fischen konnten, kam plötzlich die Genehmigung, dass die Fischer Boote als Geschenke annehmen dürften. Die drei Boote inklusive Motor und Netze, die ich von Spendengeldern kaufen konnte, sind ein Schritt in die Selbstständigkeit für die Fischer. Die Einweihungszeremonien für ein Boot sind übrigens fast dieselben wie diejenigen für ein Mädchen, das die Menarche bekommen hat.
Zusammengebrochenes Sozialsystem
Vor ein paar Tagen baten die Fischer um eine Besprechung bei mir zu Hause. Die sieben Dorfchefs kamen in Begleitung der Schuldirektorin und leiteten das Gespräch damit ein, dass sie wüssten, dass ich Ethnologin sei, schließlich seien wir seit acht Jahren Nachbarn. Und Ethnologen verstünden doch etwas von der Gesellschaft. Zum ersten Mal, soweit sie sich in der Geschichte der Fischer zurückerinnern können, sei ihr Sozialsystem zusammengebrochen, erklärten sie mir. Und zwar komplett. Die gesamte Küste entlang hätten sie Heiratsallianzen. So hätten sie in ihrem eigenen Dorf, lokal gesehen, zwar nur den Tod eines Menschen zu beklagen, jede Familie habe aber dennoch nahe Familienangehörige verloren. Bisher sei es immer so gewesen, dass man sich in Krisenzeiten, wenn zum Beispiel einmal in einer Region zu wenig Fische gefangen werden konnten, gegenseitig hätte helfen können, wegen der Verwandten, die nördlich und südlich entlang der Küste wohnten. Aber jetzt, zum ersten Mal, könne man sich nicht mehr helfen. Immer hätten sie aus ihrem Dorf Fischer hervorgebracht. Wenn man jetzt, dieser Tage, auch nur einen Verwandten im Dorf hätte, der kein Fischer wäre, sondern Arzt oder Computer-Mann oder so etwas, dann könnte derjenige allen andern helfen. Bisher hätten sie eine gute Ausbildung für ihre Kinder als überflüssig betrachtet. Netze flicken oder Fische sortieren sei wichtiger gewesen. Aber seit dem Tsunami würden sie ständig über die Zukunft ihres Dorfes nachdenken, und so hätten sie mit der Schuldirektorin schon gesprochen, denn sie hätten eine Idee, eine Bitte an mich, für den Fall, dass noch einmal ein Tsunami käme, damit ihre Kinder und Kindeskinder es dann besser haben sollten. „Richte eine Förderung ein für unsere begabten Kinder! Wir brauchen auch Verwandte, die keine Fischer sind. Diese werden die hochseetüchtigen Katamarane sein, die unsere Boote aus der Seenot retten werden.“
Nähere Informationen über den PRANA-Educational Grant (PRANA- Begabtenförderung) für die Tsunami-Kinder aus Chinnamudaliyarchavadi unter www.linkhilfe.de
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008