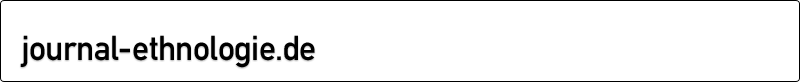
Filmrezension zu „Die weiße Massai“ (2005) von Hermine Huntgeburth
Von Ilsemargret Luttmann
Das Sujet einer exotischen, romantischen und „natürlich“ unmöglichen Liebesbeziehung zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann ist im Kontext kolonialer Herrschaftsverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren, als die ersten persönlichen Kontakte – vor dem ideologischen und machtpolitischen Hintergrund der Rassentrennung - zwischen EuropäerInnen und AfrikanerInnen stattfanden. Literarische Werke, die sich solchen Liebesabenteuern widmen, profitieren von einer westlichen Sehnsucht nach Exotik, der Lust auf Verbotenes, unbewussten Machtinstinkten und/oder dem Bedürfnis nach Kompensation für Ohnmacht. Interessanterweise klappt die Aktivierung dieses Gefühlsmusters nur in einer Konstellation von Geschlecht und Rasse, dann nämlich, wenn die Frau weiß ist der Mann aber nicht. Die Suche nach der Liebe im Fremden und der Rausch in und durch die Exotik werden grundsätzlich durch Frauen verkörpert, während europäische Männer sich als Eroberer, Forscher und Händler exponieren.
Es stellt sich nun die Frage, ob der 2005 gedrehte Film „Die weiße Massai“ – auf der Grundlage des gleichnamigen Buches von Corinne Hoffmann - eine neue, sachlichere und humanere Perspektive auf den Kulturkontakt entwickelt hat als die, die uns in Schnulzen und billigen Reisebroschüren geboten wird. Um es gleich vorweg zu nehmen, es kommt leider weder zu einer Revision des Klischees des potenten afrikanischen Mannes noch zu einer Objektivierung des kulturellen Hintergrunds in Afrika, der auch weiterhin als exotische Kulisse für das allzu aufregende Liebesabenteuer herhalten muss. Hinterfragt wird auch nicht das gängige Bild von Frauen, die sich voller Naivität und exotischer Verblendung, gepaart mit Paternalismus, auf diese ‚Reise in die schwarze Haut’ begeben. Ganz im Gegenteil, der Film führt ganz offen längst überwunden geglaubte koloniale Attitüden vor und zelebriert rassistische Bilder und Klischees!
Das Scheitern der Beziehung
Die Begegnung der beiden Protagonisten aus je unterschiedlichen Welten läuft nach einem holzschnittartigen Muster ab, das kein Klischee auslässt und durch entsprechende Bilder in ein wahres Kitschopus ausufert. Hier ist die schöne, blonde, gutmütige, unverdorbene Frau aus der westlichen Zivilisation – dort der edle Wilde in vollkommener männlicher Schönheit. Der „magischen“ Verführungskraft, die von ihm ausgeht, kann die Europäerin nicht widerstehen. Dieses Muster der Gegensätzlichkeiten: Europa - Afrika, Zivilisation - archaische Dorfwelt, Rationalität – Irrationalität, Humanität – Aberglaube durchzieht die gesamte Filmhandlung und begründet die Unmöglichkeit gegenseitigen Verständnisses und die Unausweichlichkeit der Trennung. Die Filmheldin bringt die größten Opfer bis zur Selbstaufgabe, zerbricht dann aber an den starren kulturellen Verhältnissen in Afrika, die ihrem Bild von Gleichheit, Humanität und Fortschrittsstreben nicht entsprechen, und die ihren wohlgemeinten Initiativen entgegen stehen.
Zivilisation trifft auf Natur
Die Kraft der Faszination, die von dem stolzen schwarzen Maasai-Krieger Lemalian ausgeht, wird erreicht durch die filmische Inszenierung europäischer Projektionen. Der Maasai wird zu einem erotisch verlockenden Wesen stilisiert, in dem ambivalente, widersprüchliche Eigenschaften verschmelzen. Der hoch gewachsene, perfekt proportionierte und muskulöse Maasai wird stets mit rotem Lendenschurz, mit durch rote Tonerde behandelten langen geflochtenen Haaren und mit dem, seinem Kriegerstatus geschuldeten Speer gezeigt. Damit verkörpert er vollkommene Männlichkeit, sexuelle Potenz, kriegerische Aggression und unbezähmbare Wildheit. Diesem Mannesidol wird die europäische Weiblichkeit in Form einer blonden, blauäugigen, zarten Frau, verloren in einer Welt der unübersichtlichen, chaotischen Fülle (wie das nun mal so in Afrika ist!), gegenübergestellt. Die Erscheinung des in sich ruhenden Kraft- und Naturmenschen ruft aber zugleich den entgegen gesetzten Eindruck von Hilflosigkeit und Schutzbedürftigkeit hervor, wenn er - wie ein Relikt längst untergegangener Kulturen - mitten im Tourismusbetrieb steht, wo er als Unterhaltungsprodukt konsumiert wird. Er wirkt dort mehr als Opfer, denn als stolzer Autor seiner eigenen touristischen Inszenierung. Seine imposante Haltung, die starke physische Präsenz und der direkte Blick aber werden spätestens in dem Moment als Fassade und Schutzmantel erkennbar, wenn ihm die aktive Teilhabe an der westlichen Touristenszene verwehrt wird und somit seine soziale, kulturelle und ökonomische Marginalisierung offen zutage tritt. An dieser Stelle greift das Verantwortungsbewusstsein der ach, allzu gutmütig, selbstlos erscheinenden Carola ein, die sich berufen fühlt, dieses Ungleichgewicht von „natürlicher“ Stärke und sozialer Schwäche, sowie die Entwurzelung wieder rückgängig zu machen. Der von ihr gewählte Weg führt sie aus der Stadt hinaus in das Heimatdorf von Lemalian, wo zwar alles wunderbar natürlich und ursprünglich ist und so auch bleiben soll, diesem Zustand aber mit europäischer Moral, Geld, Technik, Rechts- und Sittenverständnis nachgeholfen werden muss.
Die weiße Maasai: eine aufgeklärte Neokolonialistin
Die Konstruktion dieser transkulturellen Liebesbeziehung erfolgt aus der sehr eingeschränkten Sicht der weißen „Heldin“, die im Film wie eine aufgeklärte Neokolonialistin porträtiert wird. Sie ist einerseits tolerant, verantwortungsbewusst und tatenkräftig, andererseits völlig unvorbereitet und uninformiert. Völlig naiv begibt sie sich in das Dorf ihres Mannes, der der Ethnie der Samburu angehört und wie die meisten anderen von der Viehhaltung und unter extrem einfachen Bedingungen lebt. Auch wenn ihre soziale Integration in die Dorfgemeinschaft auf ein Minimum beschränkt bleibt und offensichtlich keinerlei Lernprozesse bei ihr stattfinden, so bleibt sie dennoch nicht passiv. Ganz im Gegenteil, sie führt der Dorfbevölkerung vor, was und wie verbessert werden muss. Sie greift ein, wenn die Samburu-Gesellschaft „versagt“. Als Maßnahme eines technischen und wirtschaftlichen Fortschritts kauft sie zunächst einen Landrover und macht dann später einen Gemischtwarenladen auf, der dazu beitragen soll, die Versorgungslage im Ort zu verbessern. Sie will im Fall der Klitorisbeschneidung einschreiten, um die Gesundheit der Mädchen zuschützen. Außerdem kümmert sie sich um sozial Ausgestoßene. Im nationalen Kontext versucht sie, sich für die kulturelle Souveränität der Samburu einzusetzen, denen der Zugang zu öffentlichen Gebäuden versagt ist, wenn sie nicht zivilisiert, das heißt europäisch gekleidet sind. Da Carola selbst keine Fragen stellt über das Denken und Handeln der Samburu, über ihre sozialen Regeln und Institutionen oder über Alltagsabläufe, wird den Zuschauern jegliches Wissen darüber vorenthalten. Für die Kinobesucher wirken die Afrikaner wie stumme Marionetten, ohne Eigendynamik, die unverständliche Dinge tun und total fremd bleiben.
Die Heldin als unverstandene Heilsbringerin
Carola fühlt sich als Opfer der fremden Kultur, in der sie sich nicht verständlich machen kann. Niemand will ihre Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft übernehmen. Dabei meint sie es wirklich gut und engagiert sich ernsthaft, wie ihr der italienische Pfarrer vor Ort bescheinigt. Auch er, der in seiner Funktion als Missionar nur predigen und ausharren kennt, weiß keinen Ausweg aus dem Dilemma. Der Eindruck einer gewissen Selbstherrlichkeit der Protagonistin entsteht, wenn nach und nach deutlich wird, dass die Zugereiste ihre Anwesenheit in dem scheinbar so authentischen, ursprünglichen Samburu-Dorf überhaupt nicht reflektiert. Glaubt sie, dass man sie dort wie eine lang erwartete Fortschrittsbringerin erwartet?
Die Missverständnisse und Unvereinbarkeiten zwischen Carola und Lemalian spitzen sich im Alltagsleben ihrer Ehe immer weiter zu. Seine unbegründete Eifersucht und sein wirtschaftlich kontraproduktiver Umgang mit dem Geschäft seiner Frau, aber auch die unterschiedliche Definition der jeweiligen Geschlechterrollen spielen bei diesem Niedergang eine zentrale Rolle. Gespräche und Informationsaustausch finden zwischen den beiden nicht statt. Die Schweizerin erduldet ihr Schicksal und strebt nach Streitfällen immer wieder die Versöhnung an.
Der schwarze Massai: ästhetisch und ideologisch modelliert nach Leni Riefenstahl
Der schöne Schwarze und seine Kultur werden im Film nicht nur in eine geografische, sondern vor allem in eine symbolische Ferne zu Zivilisation, Urbanität und Modernität gebracht. Das Dorf scheint am Ende der Welt zu liegen, fast von der Natur vereinnahmt, unzugänglich, abgeschlossen. Hinzu kommen die Sprachbarrieren: Die wenigen Gesprächsfetzen und Beiträge der Bevölkerung zum Geschehen bleiben unübersetzt. In Anekdoten werden „typische“ Merkmale vorgeführt, die die Andersheit, das Wilde und Befremdliche als die objektive Wahrheit herausstellen. Der ethnisch-kulturelle Charakter der Dorfbevölkerung und des Filmhelden wird über alle Maßen vereinfacht und überstrapaziert. Die roten Lendentücher der Männer, der unverzichtbare Perlenschmuck, der bei den Männern auffallender ist als bei den Frauen, die Ungehörigkeit des direkten Blickes seitens einer Frau dem Mann gegenüber, die Trennung in Frauen- und Männerwelten und natürlich die Tänze werden als Essenzen dieser Kultur vorgeführt. Der Film ist durchzogen von Bildern, die als Ikonen der Samburu-Kultur verstanden werden sollen, und die alle in harmonischer Nähe zur Natur zu stehen scheinen: die verkehrstechnisch nicht gezähmte Natur, die Ernährung durch Tierblut, die nomadische Lebensweise, das Schlafen auf der Erde, oder die erd- und pflanzengebundene Haar- und Hautkosmetik.
Der Maasai-Krieger wird mit allen Mittel der Kunst zu einem Objekt erotischer und exotischer Zuschauerfantasien. Uns wird ein Körper voller Scham und Unschuld mit den entsprechenden wohlgeformten Körperrundungen und idealen Proportionen dargeboten, neu erschaffen im künstlichen Licht und in der gewünschten Perspektive der Kamera. Der Rückgriff auf die Fotoästhetik von Leni Riefenstahl ist unübersehbar und verfolgt vergleichbare Ziele. Zahm und wild zugleich lädt der Maasai die blonde Frau ein, sich seinen Instinkten anzuvertrauen, und reizt sie, sich seine Urwüchsigkeit untertan zu machen.
Der Film im Dienste der Billig-Tourismusbranche
Trotz der völlig unbrauchbaren Romanvorlage, hätte der Film eine Chance zu einer Veränderung und Überwindung kolonial geprägter Sehweisen und zur Aktualisierung eines ansonsten eher schnulzenhaften Stoffs gehabt. Leider übertrifft er alle schlimmsten Befürchtungen im Hinblick auf Kitsch und paternalistisch-rassistische Untertöne. Die uns seit Jahrzehnten nur als geschnitzte tanzende Marionetten im Zentrum des ostafrikanischen Tier- und Ethno-Safaritourismus bekannten Maasais, die auch als obligatorisches dekoratives Fotomotiv in den als Weihnachtsgeschenk sehr beliebten Bildbänden über exotische Völker verewigt sind, dürfen nicht auch noch in einem Film aus dem Jahr 2005, der zudem von einer Regisseurin mit gutem Ruf stammt, in dieser diffamierenden Weise reproduziert werden.
Weiterführende Literatur
Edward M. Bruner, Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1994): Maasai on the lawn: tourist realism in East Africa. Cultural Anthropology 9(4). S. 435-70
Zur Autorin
Dr. Ilsemargret Luttmann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit afrikanischer Mode. Mehrjährige Studien- und Arbeitsaufenthalte in Westafrika. Kuratorin der Ausstellung „Mode in Afrika“ im Museum für Völkerkunde, Hamburg, vom 15.9.-12.10.2005.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008
