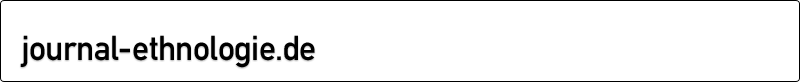
"In"- und "Ausländer" in der interkulturellen Pflege
Von Michaela Zalucki

FRAU A., 66 Jahre, alevitische Kurdin aus der Türkei, kam Anfang der 90er Jahre als Asylbewerberin zusammen mit ihrem Ehemann und mehreren Kindern in die BRD, wo sie nach Anerkennung des Asylverfahrens blieben. Frau A. spricht kurdisch und türkisch, verfügt jedoch über keine Deutschkenntnisse. Die Zuckerkrankheit von Frau A. zog bereits mehrere Krankenhausaufenthalte nach sich. Inzwischen hat ein ambulanter Pflegedienst die anfallende Behandlungspflege und Ernährungsberatung übernommen.
Frau A. fällt es sehr schwer, sich an die erforderliche Diät zu halten, was immer wieder zu Streit mit ihrem Ehemann aber auch zu gesundheitlichen – teilweise lebensbedrohlichen - Komplikationen führt.
Nach Frau A.’s Verständnis resultiert der Beginn ihrer organischen Erkrankung aus den Folgen einer Operation in der Türkei. Sie berichtet, dass bei einem Kaiserschnitt ohne Narkose ihre Gedärme auf den Boden gefallen, gewaschen und wieder eingesetzt worden seien.
HERR B., 80 Jahre alt, kam 1960 als griechischer „Gastarbeiter“ in die BRD. Bis zur Berentung mit 65 Jahren arbeitete er in der Schwerindustrie und wohnte bis vor wenigen Jahren im betriebseigenen Männerwohnheim. Seine Angehörigen leben in Griechenland, sein soziales Umfeld in Deutschland besteht aus ehemaligen Arbeitskollegen. Er spricht wenig deutsch.
Nach einem Krankenhausaufenthalt wurde ein Pflegedienst beauftragt, Grund- und Behandlungspflege sowie eine Ernährungsberatung wegen der bestehenden Zuckererkrankung durchzuführen und im Haushalt zu helfen. Herr B. hat Probleme, sich an den vorgegebenen Diätplan zu halten. Eine Änderung seiner Ernährungsgewohnheiten ist ihm nicht möglich. ‚Essen auf Rädern’ lehnt er mit der Begründung, es sei vergiftet, ab. Herr B. hatte immer den Wunsch, nach Griechenland zurück zu kehren. Er hat nach wie vor große Sehnsucht und bereitet gemeinsam mit einem Freund noch für dieses Jahr einen Besuch bei Verwandten in Griechenland vor.
Die Geschichten von Frau A. und Herrn B. sind keine Einzelfälle. Laut statistischem Bundesamt ist die Gruppe der ausländischen Seniorinnen und Senioren – erfasst werden hier nur Personen ohne deutschen Pass - die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Die skizzierte demographische Entwicklung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Bereich der Altenhilfe und insbesondere der Altenpflege. Im Falle von Herrn B. bedurfte es erst der Intervention einer Sozialarbeiterin der behandelnden Klinik, um ihn aus dem Schattendasein, das er im Schutze des betriebseigenen Männerwohnheims geführte hatte, heraus zu holen.
Die Pflege steht nun vor der Herausforderung, ihre Angebote entsprechend der Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten mit Migrationshintergrund zu öffnen und neu zu überdenken und darüber hinaus den längst bestehenden multikulturellen Teamstrukturen Rechnung zu tragen. Interkulturelle Pflege findet demnach nicht nur da statt, wo „Deutsche“ „Ausländer“ pflegen. Unter den Schlagworten „interkulturelle Kompetenz“ und „interkulturelle Öffnung“ werden Anforderungen auf der Ebene der persönlichen und fachlichen Kompetenzen von Mitarbeitenden und auch der entsprechenden Einrichtungen der Altenhilfe subsummiert, die eine Verbesserung der Versorgungsstruktur im Alter – insbesondere für ältere Migrantinnen und Migranten als neue Kundengruppe – nach sich ziehen soll.
Interkulturelle Kompetenz
Aus den geschilderten Fällen lassen sich konkrete Kompetenzanforderungen für den Pflegebereich ableiten. So muss etwa die sprachliche Verständigung sichergestellt werden, falls nötig unter Hinzuziehung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin. Doch Kommunikation geht über rein sprachliche Aspekte hinaus; bedeutet doch Sprechen auch das Transportieren von Bedeutungen. Hat Frau A. die gleichen Vorstellungen von Gesundheit, Krankheit, Altern und Pflege wie die involvierten Fachkräfte? Und welche Rolle spielt die individuelle Migrationsgeschichte in der Biografie? Diese und weitere Fragen sind zu stellen, wenn der Anspruch einer individuell zu planenden und durchzuführenden Pflege ernst genommen werden soll. Deutlich wird auch, dass der eigenkulturelle Bezugsrahmen der Pflegekräfte und des Systems Pflege an sich hinterfragt und reflektiert werden muss. Bleibt dieser Schritt aus, muss unweigerlich Frau A.’s Aussage bezüglich der Ursache ihrer Erkrankung als psychische Auffälligkeit deklariert werden, denn entsprechende Deutungsmuster haben in der stark schulmedizinisch beeinflussten Pflege hierzulande keinen Raum. Interkulturelle Bildungsangebote dienen dazu, das Bewusstsein für die veränderten Bedingungen im pflegerischen Alltag zu schärfen und das Handlungsrepertoire zu erweitern. Unbestritten ist in der interkulturellen Bildung die hohe Relevanz der Förderung der (Selbst-)Reflexionsfähigkeit. Ungeklärt bleibt jedoch weitestgehend die Frage, wie mit der Erwartung der Teilnehmenden an die Vermittlung von kulturspezifischem Wissen umzugehen ist. Der Wunsch nach „Rezeptwissen“ von Seiten der Praxis ist zwar legitim, doch gibt es keine eindeutige Antwort auf Fragen, „Wie pflege ich einen Italiener?“ oder „Was muss ich tun, wenn der Türke stirbt?“. Bevor nicht eine Sensibilisierung für die Dynamiken von ‚Kultur’ und ‚Migration’ erfolgt ist, kann die Vermittlung von kulturspezifischen aber auch –vergleichenden Inhalten zur Reproduktion von Stereotypen oder zur Kulturalisierung von Problemen anderer Genese führen.
Interkultureller Traum – monokulturelle Wirklichkeit? – Realitäten der Weiterbildungspraxis
Sieht man einmal davon ab, dass die Bestimmung von Kriterien und Merkmalen interkultureller Kompetenz dringend geboten ist, um qualitativ hochwertige Bildungsangebote machen zu können, bleibt die Frage, wer denn tatsächlich die Adressatinnen und Adressaten von Seminaren mit interkulturellen Inhalten sind. Das etwas Nebulöse interkultureller Bildung ergibt sich aus der Geschichte des Faches. Der Paradigmenwechsel von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik, sowie die Verstärkung von internationalen Austauschbeziehungen in Wirtschaft und Bildungswesen ergeben zwei Strömungen der heute unter dem Label der Interkulturalität firmierenden Seminarangebote. Zugespitzt heißt das: Kulturelle Zugehörigkeit wird in diesen Konzepten mit Nationalität gleichgesetzt. „Inländer“ werden in interkulturellen Trainings ‚fit gemacht’, um als Quasi-RepräsentantInnen die Bundesrepublik im Ausland zu vertreten, wohingegen „Ausländer“ mittels Bildung in die deutsche Gesellschaft integriert werden sollen.
Werner Schiffauer diagnostiziert in diesem Zusammenhang der deutschen Gesellschaft einen Mangel an Vertrauen in die Integrationsfähigkeit von Individuen in die Allgemeinheit. Dieses Misstrauen besteht insbesondere gegenüber „Fremden“. Ihm wird mit pädagogischen Maßnahmen begegnet. In diesem Zusammenhang stellt interkulturelle Bildung eine flankierende Maßnahme zur Anpassung von Zugewanderten an die deutsche Zivilgesellschaft dar. Interkulturelle Seminare laufen so Gefahr, ausschließlich zu monokulturellen Veranstaltungen für die Zielgruppe der Zugewanderten zu werden.
Gleichzeitig lässt sich ein weiterer Trend in die entgegengesetzte Richtung ablesen. Seit Interkulturalität besonders in der Weiterbildung im sozialen und pflegerischen Bereich boomt, finden Seminare häufig ausschließlich mit Teilnehmenden der deutschen Mehrheitsgesellschaft statt. In dieser Konstellation lauert die Gefahr der bloßen Vermittlung von Wissen über Migrantinnen und Migranten und somit einer Pauschalisierung von Biografien. Ein im strikten Sinne des Wortes interkulturelles Lernen kann nur im Dialog zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Mehr- und Minderheiten stattfinden. Die Konzeption solcher „Cross-culture“-Seminare ist eine Herausforderung, der sich die Pflege stellen sollte. Die Lernform des „zivilen Dialogs“ birgt die Chance, den machtvollen Diskurs um Interkulturalität nicht auf der Ebene des „Redens über“ sondern auf die Ebene des „Verhandelns miteinander“ zu bringen.
Allerdings ist die weitest gehende Abwesenheit von Menschen mit Migrationshintergrund in Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen eine Hürde die auf dem Weg zur Implementierung eines zivil-dialogischen Lernarrangements genommen werden muss. Die Analyse der Ursachen für diesen Zustand würde an dieser Stelle zu weit führen. Sowohl die Bundesausländerbeauftragte als auch das Forum Bildung verweisen in rezenten Publikationen auf diesen Missstand und fordern dessen Beseitigung. Empfehlungen haben jedoch keine normative Kraft. Gesetze bekanntermaßen schon. Das neue bundeseinheitliche Altenpflegeausbildungsgesetz etwa verlangt von künftigen Auszubildenden als Zugangsvoraussetzung den mittleren Bildungsabschluss. Bereits jetzt vermelden erste Altenpflegeschulen den Rückgang an Bewerberinnen mit Migrationshintergrund. Waren in zahlreichen Fachseminaren jahrelang multikulturelle Klassen die Regel, gibt es seit in Kraft treten des neuen Gesetzes teilweise wieder reine „Inländerklassen“. Werden keine flankierenden Maßnahmen ergriffen, wird der Anteil an Pflegekräften mit Migrationshintergrund drastisch sinken. Das ist um so bedauerlicher, da die personelle Besetzung – nicht nur in diesem Sektor – der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung entsprechen sollte. Partizipation und ziviler Dialog rücken somit wieder ein Stück weiter in die Ferne.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008