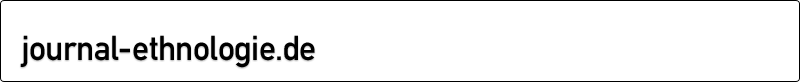
Soziale Elternschaft in Westafrika
Von Ermute Alber

Aus europäischer Sicht scheint die Vorstellung derart selbstverständlich, dass Kinder bei ihren biologischen Eltern aufwachsen sollten und nur in Krisen- oder Notsituationen an Pflegeeltern gegeben werden, dass die Thematik von Adoption oder Kindpflegschaft meist mit dem Beigeschmack problematischer sozialer Verhältnisse behaftet ist. Dass jemand seine Kinder freiwillig in Pflegschaft geben oder sie gar von einer anderen Person adoptieren lassen würde, ist in Mitteleuropa äußerst ungewöhnlich. Daher wurde lange Zeit in ethnographischen Studien die Frage wenig beachtet, bei welcher Person in einer Gesellschaft die Zuständigkeit für Kinder liegt. Dabei kann die Zuständigkeit für Kinder als die wichtigste Aufgabe der sozialen Gemeinschaft angesehen werden. Aufgrund dieser fehlenden Aufmerksamkeit wurde weitgehend übersehen, dass Kinder in vielen Teilen der Welt nicht bei den biologischen Eltern aufwachsen.
In Westafrika ist die Kindspflegschaft besonders weit verbreitet. Zwischen zehn und dreißig Prozent der Kinder wachsen je nach Land, Region und Ethnie nicht bei ihren biologischen Eltern auf. Diese Praxis wird nicht als negativ für die Kinder, ihre Entwicklung und ihren weiteren Lebensweg angesehen; weit verbreitet ist die Ansicht, dass die Pflegschaft bei anderen als den biologischen Eltern der Erziehung der Kinder förderlich sei.
Die islamischen Baatombu in Nordbenin, das Fallbeispiel dieses Textes, sind eine Gruppe von Ackerbauern, die innerhalb des westafrikanischen Kontinuums einen Extrempunkt darstellen. Bei ihnen war die Kindspflegschaft bis vor wenigen Jahren nicht nur eine Möglichkeit unter mehreren, sondern das vorherrschende Modell von Elternschaft: Fast alle Baatombu-Kinder wuchsen nicht bei den biologischen Eltern auf, sondern bei den Pflegeeltern.
Die meisten Kinder kamen in der Zeit zwischen dem Abstillen und dem siebten Lebensjahr zu ihren Pflegeeltern (meist Onkeln bzw. Tanten oder die Großeltern sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits). Zu dieser Norm der frühen Übergabe gehörte die Vorstellung, dass ein Kind idealerweise gar nicht die Namen seiner leiblichen Eltern kennen sollte. Es hielt also die Pflegeeltern für die „richtigen“ Eltern. Mädchen wurden von Frauen zu sich genommen, Jungen von Männern. Die soziale Mutter oder der soziale Vater erfüllte dabei nahezu alle Funktionen von Elternschaft, das heißt, sie oder er erzog das Kind, sorgte für Essen und Kleidung, führte es in die geschlechtsspezifischen Rollen und Arbeitsprozesse ein und organisierte und bezahlte die erste Heirat des Kindes.
Charakteristisch für diese Beziehung ist die Vorstellung (die noch heute im dörflichen Kontext weit verbreitet ist), dass die biologischen Eltern nicht das Recht haben, ihre Kinder für sich zu beanspruchen. Diese Norm findet sich im Verhalten in der Öffentlichkeit. So sprechen die biologischen Eltern aus Scham nicht die Namen ihrer biologischen Kinder aus oder reagieren möglichst nicht auf das Weinen ihrer (Klein-)Kinder, sondern warten ab, bis ein anderer ihnen das Kind zum Trösten oder Stillen bringt.

Ein weiteres zentrales Merkmal der sozialen Elternschaft bei den Baatombu ist, dass weder die biologischen Eltern noch die „Ältesten“ des Dorfes (etwa der Gehöftsherr) die sozialen Eltern eines Kindes auswählen, sondern dass diese selbst um ein Kind bitten. Vergleichbar ist dieser Vorgang mit der Bitte um die Hand einer Tochter, nur dass er mit weniger Gaben und Gütertransfers verbunden und auch insgesamt weniger ritualisiert ist. Ähnlich wie bei der Heirat ist mit der sozialen Elternschaft die Übergabe von bestimmten Verfügungsrechten verbunden: Hier ist es die Verfügung über ein Kind, über dessen Arbeitskraft, seine Zukunftschancen, seine potentiellen Versorgungsleistungen, sowie die Übernahme der Pflicht, das Kind in das Erwachsenendasein zu begleiten und ihm dafür die notwendigen Qualifikationen zu geben.
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Annahme von Jungen durch Männer und der von Mädchen durch Frauen: Soziale Elternschaft ist für die Frauen wichtig, um ihre Position im Ehegehöft zu stärken und um jemanden aus der „eigenen“ Familie bei sich zu haben. Da Frauen in den Gehöften ihrer Ehepartner als „Fremde“ leben und ihre biologischen Kinder ihnen nicht gehören, sind die angenommenen Kinder Garanten von Loyalität, aber auch von gestärkten Verwandtschaftsbeziehungen zur Herkunftsfamilie. Aus diesem Grund halten Frauen wesentlich stärker als Männer an der sozialen Elternschaft im traditionellen Sinne fest.
Es steht den biologischen Eltern nicht zu, die Herausgabe eines Kindes zu verweigern. Sie dürfen keinerlei Besitzanspruch auf ihre Kinder zur Schau stellen oder auch nur durchblicken lassen. Doch auch da, wo diese Regel respektiert wird, kommt es zu zahlreichen Konflikten, etwa wenn zwei Personen um ein Kind bitten.

Die Verheiratung von Kindern gilt als Zeitpunkt der „Auslösung“ aus der sozialen Elternschaft: Als Gegengabe für die Arbeit der Kinder wird ihnen durch die sozialen Eltern ein Heiratspartner gegeben. Dies beinhaltet beim jungen Mann den Brautpreis und beim Mädchen die Mitgift. Die Heirat bildet nicht nur den Abschluss der Kindheit und einen Übergang zu neuen Zugehörigkeitsverhältnissen, sondern auch die Auslösung aus der sozialen Elternschaft.
Die soziale Elternschaft existiert im dörflichen Kontext der Baatombu heute als eine von mehreren Formen von Kindheit, hat sich jedoch im Laufe der Kolonisierung und der postkolonialen Entwicklung stark verändert. Im dörflichen Milieu ist die Frage der sozialen Elternschaft heute ausgesprochen konfliktreich. Häufig kommt es vor, dass die Kinder – vor allem die Jungen – weglaufen und ins Gehöft der biologischen Eltern zurückkehren. Während die biologischen Eltern früher aufgrund der Ehre-Schande-Gebote die zurückgekommenen Kinder sofort wieder zu den sozialen Eltern zurückschickten, um zu signalisieren, dass sie zur Gabe der Kinder stehen, behalten sie sie heutzutage mehr und mehr bei sich. Die Norm, dass die „richtigen“ Kinder die angenommenen Kinder sind und dass diese auf keinen Fall schlechter behandelt werden dürfen als die biologischen Kinder, ist im Wandel. Viele Menschen klagen darüber, dass die sozialen Kinder ausgebeutet und schlecht behandelt werden. In den von mir über einen Zeitraum von zehn Jahren beobachteten Familien ist dies zwar keineswegs immer der Fall, statistisch nachweisbar jedoch ist, dass Kinder, die bei ihren biologischen Eltern aufwachsen, weitaus häufiger zur Schule gehen als Kinder, die bei sozialen Eltern aufwachsen.
Die sozioökonomische Grundlage der sozialen Elternschaft war, dass die Lebenschancen von Kindern nicht davon abhingen, bei wem sie aufwuchsen. In Nordbenin wurden Land und andere Produktionsmittel der bäuerlichen Wirtschaft nicht vererbt, sondern standen nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Dadurch war es für den ökonomischen Erfolg von Menschen relativ unwichtig, bei wem sie ihre Kindheit und Jugend verbrachten.
Mit der Möglichkeit, durch schulische Bildung alternative Laufbahnen einzuschlagen und sozial aufzusteigen, hat sich dies grundlegend geändert. Für den wirtschaftlichen Erfolg von Erwachsenen ist wichtiger geworden, welche Bildungseinrichtungen ein Kind besucht – und damit begannen innerfamiliäre Auseinandersetzungen, wer über diese Zukunftschancen entscheidet. Unter dem Einfluss christlicher Kolonialherren und französischer Verwaltung, die das europäische Familienmodell favorisierten, setzte sich auch in den Dörfern mehr und mehr der Gedanke durch, dass die Lebenschancen der Kinder von den biologischen Eltern mitbestimmt werden sollen. Da jedoch auch viele vorkoloniale Praktiken und Regelungen beibehalten wurden, entstand eine Vielzahl von Meinungen zur Elternschaft.
Ein massiver Wandlungsprozess der sozialen Elternschaft, der zur Herausbildung neuer Formen geführt hat, die alte und neue Elemente integrieren, setzte jedoch nicht so sehr innerhalb der dörflichen Bevölkerung ein, sondern zwischen Dörflern und Städtern.

Seit etwa vierzig Jahren schon werden Kinder von Städtern nicht mehr von Dörflern angefragt. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Stadtkinder durch Schulbildung Zugang zu den neuen Aufstiegsmöglichkeiten haben und ihre städtischen Eltern ein Familienbild bevorzugen, bei der die biologischen Eltern für ihre Kinder sorgen.
Im Verhältnis zwischen Stadt und Land geht der Austausch von Kindern heutzutage in eine Richtung: Nur die Städter bekommen Landkinder angeboten, oder sie fragen nach ihnen. Diese Kinder gehen in der Stadt zur Schule oder machen dort eine Ausbildung und arbeiten zugleich in den städtischen Haushalten mit. Diese Aufnahme von Kindern in der Stadt hat für beide Seiten Vorteile: Die ländlichen Haushalte können ihren Kindern Zugang zu Bildungseinrichtungen besorgen, die städtischen haben Arbeitskräfte.
Zugleich werden manche alten Normen beibehalten. So sind Städter wie Dörfler fest davon überzeugt, dass es gut für Kinder ist, nicht ausschließlich bei den biologischen Eltern aufzuwachsen. Jahrelange, aber gleichwohl temporäre Abwesenheiten der Kinder wegen Schulbesuch, Ausbildung oder nur „um Erfahrungen zu machen“ werden von allen Beteiligten gutgeheißen. Dies ist auch ein Grund, warum sich Internate bereits während der Kolonialzeit, aber auch bis heute, großer Beliebtheit erfreuen. Die europäische Vorstellung, dass der Wechsel von Bezugspersonen Schaden anrichten könne, wird nicht geteilt.
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass Kindheiten in Nordbenin heutzutage vielfältiger geworden sind, und es wird gerade auch über die sich wandelnden Normen unablässig gestritten und verhandelt. Es steht jedoch fest, dass bei allen Wandlungsprozessen die soziale Elternschaft trotz des großen Einflusses der europäischen Normen nicht verloren geht, sondern weiterhin in großen Teilen üblich und normal geblieben ist.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008