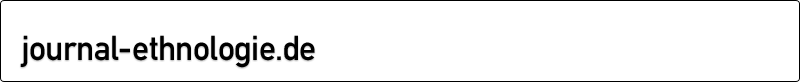
Ein medizinhistorischer Diskurs des 19. Jahrhunderts
Von Marion A. Hulverscheidt
Die weibliche Genitalverstümmelung wird je nach Standpunkt als medizinisch notwendiger Eingriff, als Disziplinierungsmaßnahme oder als ein kulturelles Ritual angesehen. Bereits in Medizinbüchern des 19. Jahrhunderts werden ethnologische Beschreibungen über die rituelle weibliche Beschneidung bei afrikanischen Völkern beschrieben. Damals waren Fachgrenzen noch nicht festgeschrieben, und viele Mediziner waren (kultur-)anthropologisch interessiert. Auch stellten sie eine erkleckliche Zahl von Forschungsreisenden, „Expediteuren“, die in fremde Welten aufbrachen, um diese zu erforschen. Sie nahmen ihren Denkstil, ihre Art und Weise die Welt zu erklären, ihr ethnozentrisches Weltbild mit.
In Europa übliche Indikationen für die operative Behandlung des äußeren Genitale waren Masturbation, übermäßige Wollust oder die vermeintlich pathologische Vergrößerung der Schamlippen und/oder der Klitoris. Diese Indikationen wurden von europäischen Afrika-Reisenden auch als Begründungen für die rituelle weibliche Beschneidung afrikanischer Völker angeführt.
Die als "Hottentottenschürze" bezeichneten verlängerten Schamlippen galten in Europa als pathologisch, beziehungsweise pathognomonisch, das heißt auf die krankheitsverursachende Masturbation hinweisend. Bei Afrikanerinnen wurden sie von einigen Medizinern und Anthropologen als Rassenmerkmal angesehen, und zwar nicht nur bei den "Hottentotten", den heute als Khoi-Khoi bekannten, im südlichen Afrika lebenden ethnischen Gruppen. Auch dort, wo das Vorkommen verlängerter Schamlippen nicht beobachtet wurde, sondern nur die Beschneidung am Genitale, wurde die Hässlichkeit der "Hottentottenschürze" oder das dadurch entstehende vermeintliche Kohabitationshindernis als notwendige Begründung für das Beschneidungsritual angegeben. Auch in Europa wurde die Beschneidung zur Behandlung der angeblich durch Masturbation entstandenen Hypertrophie empfohlen. Ähnlich wurde auch die vermeintliche Notwendigkeit der bei einigen afrikanischen Ethnien üblichen Klitorisdektomie erklärt.
Joseph Hyrtl schrieb 1850 in seinem Anatomielehrbuch über die inneren Schamlippen: "Ihre bei gewissen Völkern constant vorkommende Verlängerung (im nördlichen Afrika), erfordert die blutige Resection derselben. – Die Clitoris ist in südlichen Zonen größer, als in den gemäßigten und kalten Breiten. Bei den Abyssinierinnen, den Mandingo und Ibbos, so wie bei hermaphroditischen Frauen ( Androgynae ), ist ihre Größe bedeutend und erfordert bei ersteren ebenfalls die Beschneidung als volksthümliche Operation." (Hyrtl 1850: 533). Hyrtl zieht hier einen dem Eurozentrismus geschuldeten Zirkelschluß: Nicht die vergrößerten Genitalien hatte er gesehen, sondern lediglich den Zustand nach einer rituellen weiblichen Beschneidung. Aus der Tatsache, dass beschnitten wurde, folgerte er, dass die Schamlippen vergrößert gewesen seien.
Die Ethnologie konstituierte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zeitgleich mit medizinischen Fachdisziplinen wie die Gynäkologie als universitäre Wissenschaft. Diese Vermengung von ethnologischem Wissen und medizinischen Vermutungen gipfelte in dem Wunsch, körperliche Merkmale der Verschiedenheit zu finden, anhand derer die Überlegenheit der europäischen Rasse gezeigt werden konnte. Das weibliche Genitale war davon nicht ausgenommen, wenngleich hier durch die künstlichen Veränderungen die Unterscheidung und Differenzierung äußerst schwierig war.
Allerdings waren sich die westlichen Forscher über den Grund der rituellen weiblichen Beschneidung nicht einig. Hermann Heinrich Ploss (1819-1885), Ethnograph und Arzt, versuchte das bekannte Wissen darüber in einem Beitrag zur "operative n Behandlung der weiblichen Geschlechtstheile bei verschiedenen Völkern" 1871 darzustellen. Die rituelle weibliche Genitalverstümmelung werde unter anderem durchgeführt, um die Onanie zu verhindern und um dem Entstehen von monströs vergrößerten Genitalien vorzubeugen, meinte er.
Für auffallend große weibliche Genitalien wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Begriff "Hottentottenschürze" geprägt. Dieser Begriff war im Laufe des 19. Jahrhunderts einem Bedeutungswandel unterworfen; zunächst als eine Varietät begriffen, nicht als ein Rassenmerkmal, wurde sie schließlich zu einer Pathologie, die sich weltweit bei Frauen finden konnte. "Hottentottenschürze" wurde jedwede Vergrößerung und Verlängerung am äußeren weiblichen Genitale genannt, sei sie angeboren oder erworben. Die "Hottentottenschürze" war auch die gängige Metapher des 19. Jahrhunderts für das angeblich wollüstige, nymphomane und laszive Wesen der Afrikanerin.
Traurige Berühmtheit hat in diesem Zusammenhang Sarah Baartman erlangt, eine Angehörige der "Hottentotten", die in Europa als "Hottentottenvenus" auf Jahrmärkten und in Völkerschauen ausgestellt wurde. Der berühmte Pariser Zoologe und Naturforscher George Cuvier (1769–1832) wollte die Dame an ihren Schamteilen untersuchen, was diese jedoch nicht zuließ. Erst nach ihrem Tod konnte Cuvier den Leichnam examinieren und seinen Erkenntnisdrang über die "Hottentottenschürze" befriedigen. Die von ihm angefertigten anatomischen Präparate der Geschlechtsteile von Sarah Bartmann wurden noch bis 1974 im Pariser Musée d l'Homme ausgestellt, 2002 wurden die Überreste von Baartman in einer feierlichen Zeremonie in Südafrika beerdigt.
Die "Hottentotten" wurden von europäischen Ethnologen auf der untersten Ebene der Rassen angesiedelt, ganz gleich, ob die Einteilung von einem Polygenisten oder Monogenisten, einem Befürworter oder Gegner der Sklaverei vorgenommen wurde. Den Afrikanern oder der "abessinischen Rasse" wurde nachgesagt, dass sie einen sehr starken Geschlechtstrieb hätten, was daran zu erkennen sei, dass ihre Geschlechtsteile groß angelegt seien. Wurde bei europäischen Mädchen und Frauen eine Vergrößerung der Klitoris oder der Schamlippen beobachtet, wurde dies auch als "Hottentottenschürze" bezeichnet. Diese Benennung trug mit dazu bei, dass eine mögliche Normvariante zu einer behandlungsbedürftigen Pathologie umgedeutet wurde.
Was die "Hottentottenschürze" eigentlich sei und wie sie entstehe, waren Fragen, die im späten 18. und im gesamten 19. Jahrhundert unter Ethnologen und Medizinern diskutiert wurden. So argumentierte der Berliner Anatom Hartmann, in der Diskussion darüber, ob die "Hottentottenschürze" eine Rasseeigentümlichkeit der "Buschmänninnen" sei oder eine allgemein verbreitete Variante, wie folgt: "Die Hottentottenschürze braucht man nicht bloss in Süd-Afrika zu suchen, man findet sie durch den ganzen Continent, sogar in Europa noch häufig genug! Jeder Stubenethnolog würde erstaunen, wenn ich ihm ein Glas voll sogenannter Hottentottenschürzen, aus dem Präparirsaal der Haupt- und Weltstadt Berlin stammend, fein säuberlich in Alkohol aufbewahrt, vorweisen würde." (zit. n. Ploss/Bartels 1891: 223)
Hier muss erläuternd hinzugefügt werden, dass die Vergrößerung der äußeren Genitalien bei der europäischen Frau gesondert beurteilt wurde. Waldeyer, der den Katalog der Sammlung des Anatomischen Museums führte, in dem die Präparate verzeichnet sind, auf die Hartmann anspielt, gab zu jedem Präparat gesondert an, ob es sich um eine Bildungsabweichung oder um eine durch Masturbation bedingte Hypertrophie handelte.
So hieß es in den Krankenberichten von masturbierenden Kindern immer wieder, dass ihre Genitalien "sehr entwickelt" oder "groß und welk" seien. Dieser Zustand allein wurde jedoch nicht als Handlungserfordernis betrachtet. Nur im Zusammenhang mit anderen Indizien, die auf Masturbation hinwiesen, kam diesem Zustand ein Krankheitswert zu.
Masturbation als Erklärung für das Entstehen vergrößerter Genitalien findet sich in einigen Reiseberichten aus Afrika. Als Beweis für Masturbation reichten den Forschern indes allein schon die vergrößerten Genitalien. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass sie selbst Menschen bei der Masturbation beobachtet hatten. Die europäischen Expediteure haben die ethnozentrische Annahme, dass Personen, die masturbieren, einen gesteigerten Geschlechtstrieb hätten, und dass dadurch die äußeren Genitalien gemeinhin vergrößert seien, auf ihr Forschungsgebiet übertragen.
Im 19. Jahrhundert war es durchaus üblich, als "Stubenethnologe" zu arbeiten, also ohne eigene Feldforschungserfahrung aus zweiter oder dritter Hand Völker und ihre Eigentümlichkeiten zu beschreiben. Aus dieser Perspektive erschien der Kontinent Afrika wie ein einziges Land. Das Zusammenfügen von Erfahrungen und Wissen aus verschiedenen Teilen Afrikas, von verschiedenen Forschern und die –in der Rückschau gesehen – unreflektierte Art des Erkenntnisgewinns aus dieser Methode, ließ Erklärungsmuster entstehen, die den realen Umständen nicht standhielten.
Weiterführende Literatur
Fausto-Sterling A. (1995): Gender, Race, and Nation. The Comparative Anatomy of "Hottentot" Women in Europe, 1815-1817. In: J. Terry , J. Urla (Hg.): Deviant Bodies. Blooington and Indianapolis. S. 19–48
Gilman, G. (1985): Difference and Pathology, Stereotypes of Sexuality, Race and Madness. Ithaca
Hulverscheidt, Marion A. (2005): Eine merkwürdige Methode zur Verhinderung der Onanie. Zur Geschichte der Genitalverstümmelung von Frauen im deutschsprachigen Raum. In: Zeitschrift für Sexualforschung 18. S. 215–242
Ploss, H. H.; M. Bartels (1891): Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. 3. Auflage Leipzig
Schmersahl, K. (1998): Medizin und Geschlecht – Zur Konstruktion der Kategorie Geschlecht im medizinischen Diskurs des 19. Jahrhunderts. Opladen
Zur Autorin
Dr. med. Marion Hulverscheidt, Medizinhistorikerin und Ärztin, Institut für Geschichte der Medizin der Universität Heidelberg.
Hulverscheidt, Marion A. (2002): Weibliche Genitalverstümmelung. Diskussion und Praxis in der Medizin während des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Frankfurt/M
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008

