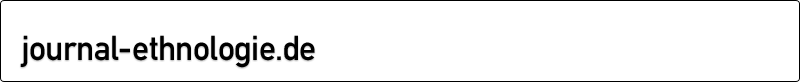
Klientel- und Tauschbeziehungen im städtischen Milieu Westafrikas
Von Andrea Reikat
„In vielen Kulturen finden Austausch und Verträge in Form von Geschenken statt, die theoretisch freiwillig sind, in Wirklichkeit jedoch immer gegeben und erwidert werden müssen. Da diese Moral und die Ökonomie unterschwellig auch noch in unseren eigenen Gesellschaften wirken und da wir glauben, hier einen Fels gefunden zu haben, auf denen unsere Gesellschaften ruhen, können wir daraus einige moralische Schlussfolgerungen ziehen.“
Ausgehend von diesen Sätzen, geschrieben von Marcel Mauss vor nahezu 60 Jahren, sollen die Tauschbeziehungen in Ouagadougou analysiert werden – wobei wir das Wort „Tauschbeziehungen“ im wörtlichen wie im übertragenen Sinn betrachten, im Austausch von Gaben ebenso wie von Gesten.
Der 19. Dezember 2007, der 25. Dezember, der 1. Januar – Feiertage in Ouagadougou: Tabaski (das islamische Hammelfest), Weihnachten, der Neujahrstag. Während an solchen Tagen in Deutschland die Bürgersteige hochgeklappt zu sein scheinen und allenfalls am Mittag oder am Nachmittag Familien zu den Grosseltern eilen, um ein traditionelles Mittagessen oder Kaffeetrinken einzunehmen, sind diese Tage in der Hauptstadt Burkina Fasos Tage höchster Geschäftigkeit: die ganze Stadt scheint auf den Beinen bzw. auf den Rädern zu sein, der Straßenverkehr wirkt dichter als an einem normalen Werktag und vor allem: die Leute, die unterwegs sind, strahlen keineswegs eine Stimmung feiertäglicher Ruhe aus, sondern hasten von einem Ende der Stadt zum anderen. Was von außen wie ein chaotisches Gewimmel anmuten mag, hat im Inneren durchaus Struktur. Die Kernfrage zum Verständnis ist: wer bewegt sich (und wohin) und wer nicht (und warum).
Um die Antwort bereits vorwegzunehmen: je höher der Status der einzelnen Person ist, desto geringer ist seine Mobilität, je geringer der Status ist, desto mehr muss man sich bewegen.
Tabaski: jeder Familie ihren Hammel
Es ist eine Verpflichtung für jeden muslimischen Familienvater, am Tag des tabaski, 40 Tage nach Ende des Fastenmonats Ramadan, einen Hammel zu schlachten. Die „Jagd“ nach dem Hammel zu vergleichen mit der in Deutschland üblichen nach dem Weihnachtsbaum, hieße diese Verpflichtung zu verniedlichen, da sich eine deutsche christliche Familie ohne Weihnachtsbaum durchaus vorstellen lässt, nicht aber eine muslimische ohne Hammel.
Für die Familienväter ist die Frage des richtigen Zeitpunkts des Hammelkaufs eine delikate und komplizierte: kauft man zu früh, muss man das Tier über einen langen Zeitraum im heimischen Hof ernähren, außerdem wächst die Gefahr, dass sich zwischen dem Opfertier und den Familienangehörigen eine emotionale Bindung entwickelt, die das Schlachten am Festtag schwierig werden lässt. Je länger man allerdings wartet, desto höher steigen die Preise. Manche spekulieren darauf (ähnlich wie beim Weihnachtsbaumkauf), dass die Händler am letzten Tag vor dem Fest oder am Morgen des Festes selbst die Nerven verlieren und die Preise senken: aber sicher kann man sich da nie sein, insbesondere wenn – wie im Jahr 2007 – unmittelbar nach dem Tabaski -Fest noch Weihnachten und Neujahr anstehen und die zu Tabaski nicht verkauften Hammel anschließend noch andere Abnehmer finden können.
Es gibt aber noch einen anderen Grund, der viele Familienväter lange zögern lässt: alle diejenigen, die sich zumindest auf einer mittleren Stufe der sozialen Leiter befinden, spekulieren darauf, irgendwann vor dem Fest von irgend jemandem, der sich positiv in Erinnerung rufen will, einen Hammel geschenkt zu bekommen. Und kaum etwas ist ärgerlicher, als zwei Tage vor dem Fest fast einen ganzen Monatslohn für einen Hammel ausgegeben zu haben, und dann einen geschenkt zu bekommen; ein Geschenke, das schlussendlich den Kauf überflüssig macht.
Ist der Festtag gekommen gehen die Familienväter morgens zum Gebetsplatz, während die weiblichen Mitglieder der Familie (manchmal die Hausfrau, immer aber eine ganze Armada von Hausangestellten, herbeigerufenen jüngeren Schwestern, Nichten u.a.) in der Küche beschäftigt sind. Nach dem Gebet geht es dem Hammel im wörtlichen Sinne „an die Gurgel“. Ab diesem Zeitpunkt vergrößert sich der zeitliche Druck (der in der Küche ja ohnehin schon seit dem Morgengrauen herrscht), denn die ersten Besucher erscheinen in der Regel unmittelbar nach dem Gebet: idealerweise sollten aber alle Besucher mit einem Gericht bewirtet werden, dass mit dem Fleisch des Tabaski -Hammels zubereitet ist. Dass dies nicht einfach zu bewerkstelligen ist, leuchtet jedem ein, der sich in Küchendingen ein wenig auskennt: der Hammel landet ja nicht direkt nach dem Schlachten auf den Teller, sondern er muss zunächst gehäutet und auseinander genommen, zerteilt und dann schließlich ja auch noch gekocht werden.
Das Fleisch des Hammels wird zwei verschiedenen Verwendungen zugeführt: zum einen werden die Nachbarn und Verwandte bedient. Unter ersteren sollen – den religiösen Regeln zufolge – diejenigen bevorzugt werden, die sozial nicht so gut gestellt sind (Witwen vor allem), ansonsten bedenkt man all die, zu denen man ein besonders gutes Verhältnis hat oder mit denen man sich aus welchem Grund auch immer gut stellen will. So wandern also gegen den späten Vormittag Unmengen von Töpfen durch die Viertel und – was den Austausch zwischen den Verwandten anbelangt – durch die ganze Stadt: Couscous mit Hammelsauce von A nach B, in Öl gekochter Reis mit Hammel von B nach C, Spaghetti mit Hammel sowie grüne Bohnen mit Hammel wiederum von B und C nach A. Ähnlich wie bei den Besuchen – auf die jetzt direkt im Anschluss zu sprechen zu kommen sein wird – kann jede einzelne Familie an der Anzahl der entsendeten und der empfangenen Gerichte ihren Status ablesen: hat sie mehr empfangen als entsendet, ist ihr sozialer Status intakt, hat sie hingegen mehr entsendet als empfangen, sollte sie dies als Alarmzeichen für ihre soziale Akzeptanz werten.
Womit wir nun bei der Frage der Besuche angelangt wären. Wenn doch jede Familie mit den zuvor beschriebenen Tätigkeiten beschäftigt ist, wer hat denn dann noch die Zeit und die Energie, um als Besucher vorbeischauen zu können? Neben den Angehörigen der jeweils anderen der großen Religionen (also beim Tabaski die Christen, die bei ihren muslimischen Nachbarn und Freunden vorbeischauen) gibt es da noch die jungen Leute, die tatsächlich noch nicht in familiärer Verantwortung stehen. Während die jungen, unverheirateteten Mädchen an solchen Tagen zum Kontingent des mehr oder weniger freiwilligen Küchenhilfen zu rechnen sind, ziehen die jungen Männer von einem Hof zum anderen, um das Maximum an gutem Essen und Trinken für sich herauszuholen (wobei es nicht so ist, dass die in der Küche helfenden Mädchen an diesen Tagen Hunger leiden: der Anteil des direkt in den Mägen oder Handtaschen der Küchen“hilfen“ verschwindenden Essens darf nicht zu gering eingeschätzt werden). Hinzu kommt eine Zwischenkategorie von jüngeren Familienangehörigen: Diejenigen, die beschließen, sich an solchen Tagen noch nicht als wirkliche Familienchefs zu fühlen (auch wenn sie de facto schon seit Jahren mit Frau und Kindern einen eigenen Haushalt führen), sondern sich in einen Status von Unmündigkeit zurückfallen zu lassen, indem sie keine eigenen Festvorbereitungen treffen, sondern sich lieber den ganzen Tag bei Verwandten und Vorgesetzten bewirten lassen. Die wichtigste Kategorie der Besucher sind aber diejenigen, die an solchen Festtagen sozial Höherstehenden ihre Referenz erweisen: aktuelle und ehemalige Angestellte und Mitarbeiter, ehemalige Mitschüler, die es auf der sozialen Leiter nicht ganz so weit gebracht haben, Leute, denen man irgendwann einmal geholfen hat und so weiter.
Die unzweifelhaft größte logistische Leistung erbringt dabei das große Heer derjenigen, die auf der mittleren Ebene des sozialen Gefüges stehen: diejenigen, die eine eigene Familie haben und Leute, die sich von ihnen abhängig fühlen, die aber dennoch an diesen Tagen ihren älteren Verwandten, aber auch ihren Vorgesetzten oder anderen Förderern gegenüber ihre Ergebenheit dadurch beweisen zu müssen glauben, dass sie bei diesen vorbeischauen und zumindest eine kurze Zeit lang – für ein Getränk und einen Teller mit frisch zubereitetem Essen – dort verbleiben. Während also diejenigen, die auf der Statusleiter weit oben stehen, an solchen Tagen „nur“ die Last des Wirts zu tragen haben (dies allerdings bei manchmal weit über 100 zu bewirteten Gästen), so fallen bei den sozial im Mittelfeld Angeordneten beide Verpflichtungen zusammen: selbst kochen, Getränke sowie eine Basisinfrastruktur zur Bewirtung von Gästen bereithalten, andererseits aber auch eine lange Liste von zu besuchenden Höherstehenden „abarbeiten“.
Die anderen Feste: Weihnachten und Neujahr
2007 lagen die zentralen Feste – das Tabaski der Moslems und das Weihnachtsfest der Christen – in einem Abstand von nur wenigen Tagen zusammen. So hatten die Moslems schon recht bald Gelegenheit, nun ihrerseits, ohne eigenen Verpflichtungen, bei ihren christlichen Nachbarn, Freunden und Verwandten vorbeizuschauen.
Dabei unterliegt die Ausgestaltung des Weihnachtsfestes nicht so strengen Regeln wie die des Tabaski . Man ist frei in der Art der zuzubereitenden Speisen, man kann auch schon am Vortag damit beginnen (aber wer tut das schon?), man kann Essen an bedürftige oder befreundete Nachbarn senden, muss es aber nicht.
Ansonsten unterscheidet sich der Ablauf in den Haushalten nur wenig: die ersten Gäste kommen am späten Vormittag, die letzten gehen am späteren Abend, alle erwarten zumindest ein Getränk mit Knabbereien (Popcorn, Erdnüsse, Kroupouk), eigentlich aber eine „anständige“ Mahlzeit mit viel Fleisch.
Während an den religiösen Festen die hierarchischen Beziehungen bezüglich der Frage, wer eigentlich wen besuchen muss, noch durch die religiösen Zugehörigkeiten überlagert werden, kommt am Neujahrstag die hierarchische Komponente am deutlichsten zutage. Der Angestellte besucht seinen Chef, der jüngere Bruder den älteren, der Auftragnehmer den Auftraggeber, der ehemalige Mitarbeiter den ehemaligen Chef, der Schüler den Lehrer etc. – und die meisten bringen sie noch Freunde oder Verwandte mit, teils weil man ohnehin gemeinsam unterwegs ist (auch um Benzinkosten zu sparen) oder aus anderen Gründen, auf die im folgenden noch einzugehen sein.
Für die sozial am oberen Rand der Skala Stehenden heißt dies: sie müssen an solchen Tagen hunderte von Leuten nicht nur bewirten, sondern auch persönlich begrüßen und ihrer Freude über den Besuch Ausdruck verleihen. Andererseits erwartet von den wirklich Hochgestellten niemand, dass sie ihrerseits Besuche abstatten und außerdem sind sie es, die im Vorfeld am stärksten von Geschenken profitieren. Von überall her treffen Schafe, Hühner, Säcke mit Hirse und – neuerdings – Präsentkörbe oder Kartons mit Spirituosen ein, gesendet von Leuten, die die Gelegenheit nutzen, um sich positiv in Erinnerung zu bringen, die aber ihrerseits nur selten zum Fest kommen werden – die mit dem entgegengenommenen Geschenk eingegangene Verpflichtung wird nicht sofort eingefordert, sondern irgendwann später und viel subtiler.
Wie beim Tabaski stehen auch bei den anderen Festen diejenigen am anderen Ende der Skala, die sich ausschließlich wie „Abhängige“ benehmen können: selbst also kein Fest ausrichten müssen, sondern durch die ganze Stadt von Gastgeber zu Gastgeber fahren. Allerdings haben selbst diese, wie zuvor bereits erklärt, die Möglichkeit, sich ihrerseits als Gönner zu gerieren: indem sie nämlich noch niedriger gestellte Freunde oder jüngere Brüder zu höher gestellten Persönlichkeiten mitnehmen, sei es nur, damit diese dort auch gut essen können oder aber, um diese in Verbindung zu bringen für ein konkretes oder auch ein möglicherweise erst später akut werdendes Anliegen.
Und wie auch beim Tabaski so sind auch bei den anderen Festen diejenigen in der schwierigsten Situation, die sich auf einer mittleren sozialen Ebene befinden: diejenigen, die einerseits zu Hause ein Fest ausrichten, andererseits aber auch zu älteren Verwandten, Vorgesetzten und anderen für sie wichtigen Persönlichkeiten fahren müssen.
Dass es um „müssen“ geht, also um eine Verpflichtung, wird am deutlichsten an den im engeren Sinne privaten Festen, wie zum Beispiel Taufen oder den zumeist am Nationalfeiertag erfolgenden Ordensverleihungen. Wer an diesem Tag das „Pech“ hat, dass bei einem älteren Verwandten oder einem Vorgesetzten das gleiche Ereignis stattfindet, sieht sich gezwungen, sein eigenes Fest zumindest zeitweise zu verlassen, um das des jeweils Höhergestellten aufzusuchen. Denn jeder hat Angst, dass ein eventuelles Fernbleiben negativ vermerkt werden und sich nachteilig auf das Verhältnis zum Höhergestellten auswirken könnte.
Gleich und gleich?
Wen man an solchen Festen so gut wie nie sieht, das sind die engsten Freunde, diejenigen, die einem verbunden sind ohne Gegenleistungen zu erwarten, sowie all die Personen, die sich auf derselben Rangstufe befinden wie man selbst. Der wechselseitige Besuch von Gleichgestellten passt nichts ins Schema, außerdem mag auch ein Gefühl von Rücksichtsnahme mitspielen: man weiß aus eigener Erfahrung, was bei dem anderen los ist und will nicht noch zusätzlich zur Belastung werden. Freunde und Gleichgestellte treffen sich, wenn überhaupt, am Ende solcher Feste auf neutralem Boden (in irgendeiner Kneipe), um außerhalb des heimischen Chaos noch in Ruhe ein Bier zu trinken und unabhängig von unterschwelligen Forderungen von Besuchern, die ja zumeist auch Bittsteller sind, möglichst ungefilterte Gespräche führen zu können.
Tabaski, Weihnachten, Neujahr: Feste als Spiegel von Klientelbeziehungen Analysiert man die Bewegungen von Waren und Personen zu den großen Festen in Ouagadougou, so erfährt man, wer von wem abhängig ist oder sich von wem abhängig fühlt. Fährt der Bauunternehmer zum Ministerialbeamten oder umgekehrt? Suchen ehemalige Mitarbeiter ihren früheren Chef auf oder befindet dieser sich mittlerweile in einer Position, in der er ihnen nicht mehr nützlich sein kann? Kommen noch Massen von Leuten zu einem in Ungnade gefallenen Politiker oder hat er keine signifikante Anhängerschaft mehr?
Dabei folgen gesendete Geschenke und abgestattete Besuche dem gleichen Schema: beide dienen dazu, sich in Erinnerung zu bringen. Nur in seltensten Fällen werden eventuelle Wünsche anlässlich des Festes vorgebracht werden, aber man zeigt demjenigen, den man besucht, dass man sich ihm weiterhin verpflichtet fühlt. So erschöpft sich die Verpflichtung des Höhergestellten nicht darin, seine Besucher gut zu bewirten: nein, er weiß, dass diejenigen, die da kommen, ihn auch in Zukunft aufsuchen werden, wenn sie ein Problem nicht alleine lösen können. Und ihrerseits glauben die Besucher, nur dann auf zukünftige Hilfestellungen rechnen zu können, wenn sie dem potentiellen Helfer aus Anlass der großen zentralen Feste (aber auch dazwischen immer wieder) ihre Referenz erwiesen haben.
Klientelbeziehungen definieren sich als „ein System personeller, ungleicher Abhängigkeits-Beziehungen … zwischen einflussreichen Personen und ihren Klienten auf der Grundlage von Leistung und Gegenleistung“, und in diesem Sinne verstehen wir die zuvor beschriebenen Besuche und Geschenke als Manifestation von Klientelbeziehungen. Die abschließende Frage ist nun, was die Höhergestellten eigentlich davon haben. Evident ist die Antwort im Falle der Politiker: sie brauchen eine möglichst große Anzahl von Anhängern, oder besser: Abhängigen, um ihre Karriere zu garantieren. Dabei folgt das System dem der Abhängigkeitsverhältnisse an den afrikanischen Königshöfen, in denen der „gute“ Herrscher sich in erster Linie dadurch auszeichnet, dass er für seine Untergebenen da ist, sich um sie kümmert, wohingegen diese ihm im Gegenzug folgen und ihm ihre Referenz erweisen müssen. Hingegen ist der „Nutzen“ des Systems für den mittleren Angestellten oder Beamten oder das einfache Familienoberhaupt wesentlich indirekter, wenn überhaupt. Er kann vielleicht darauf hoffen, dass es irgendeiner der heutigen jüngeren Verwandten oder Mitarbeiter später einmal in eine einflussreiche Situation schaffen wird, in der er sich dankbar der Hilfe des vormals Höhergestellten erinnert (man hofft also eigentlich auf eine zukünftige Umkehrung der Rolle), darüber hinaus ist sein Lohn eher indirekter Art und lässt sich allenfalls mit dem eher vagen Begriff der gesellschaftliche Anerkennung (bzw. Nicht-Ächtung) beschreiben.
Kommen wir zum Abschluss auf den zweiten Teil von Marcel Mauss’ eingangs zitierter Bemerkung zurück, in dem er davon sprach, dass „diese Moral und die Ökonomie unterschwellig auch noch in unseren eigenen Gesellschaften wirken“. Auch in Deutschland lässt sich der eigene Status an der Relation von gemachten und erhaltenen Geschenken ablesen: den Bauunternehmer, der seinem Kredit- oder Auftraggeber zu Weihnachten Präsentkörbe schickt, gibt es auch hier, ebenso den Neffen, der es keinesfalls versäumt, seiner Erbtante zu Weihnachten Grüsse zu senden. Allerdings würde es in Deutschland wohl als höchst unschicklich empfunden, zu den hohen Festtagen bei Vorgesetzten persönlich zu erscheinen. Was darin zum Ausdruck kommt, ist – in Deutschland – eine klare Unterscheidung zwischen beruflicher und privater Sphäre. Diese Unterscheidung fehlt in Burkina Faso vollständig – sie wird auch nicht bei den Hilfsleistungen, die der Abhängige vom Höhergestellten erwartet, gemacht. Der Vorgesetzte wird eben nicht nur bei beruflichen Dingen um Hilfe gebeten, sondern auch bei der Krankheit der Ehefrau sowie bei der Beerdigung des Großvaters um Geld gebeten oder auch wenn für die Kinder ein Schulplatz zu organisieren ist. Während im europäischen Kontext die private von den diversen beruflichen und offiziellen Sphären weitestgehend getrennt ist, so durchwebt das burkinische Klientelsystem die Ebenen und lässt die Grenzen zwischen privatem und beruflichem bis zur Unkenntlichkeit verschwinden. Und in diesem Kontext ist es vollkommen logisch, dass es die Höflichkeit eben nicht erfordert, den Vorgesetzten an hohen Feiertagen in Ruhe feiern zu lassen, sondern ihm durch zahlreiches Erscheinen seine Beliebtheit nachdrücklich zu beweisen. Dieser wird dann schon merken, in welcher Form er sich seinerseits für die anlässlich des Festes erwiesene Aufmerksamkeit erkenntlich zeigen wird müssen...
Zur Autorin
Dr. Andrea Reikat ist Privatdozentin für „Historische Ethnologie“ an der „Johann Wolfgang Goethe-Universität“ in Frankfurt/M., z.Zt. an der Universität Ouagadougou in Burkina Faso (Westafrika). Seit 1992 jährlich Feldforschungen in Burkina Faso und Benin.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008




