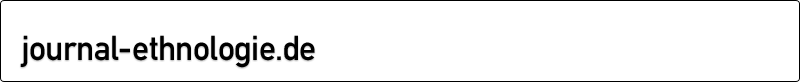
Von Meinhard Schuster
Im Nordosten Neuguineas erstreckt sich zwischen dem bis auf rund 5000 Meter ansteigenden, die ganze Insel durchziehenden Zentralgebirge und den weit niedrigeren Hügelzügen entlang der Nordküste das Schwemmlandbecken des mittleren und unteren Sepik, der – im Hochgebirge entsprungen und im ganzen nur wenig kürzer als der Rhein – hier auf dem zweiten Teil seines Weges bei schwachem Gefälle in vielen, sich immer wieder verändernden Windungen nach Osten dem pazifischen Ozean zustrebt. Dieser irritierende Wechsel des Flusslaufs wird vor allem durch den Abbruch des Uferlandes an den Aussenseiten der Windungen und den häufig folgenden Durchbrüchen der Strömung zur nächsten Schlinge verursacht. Aus dem bisherigen Flusslauf werden dabei teilweise Lagunen, an denen oft grosse und geschichtlich bedeutende Dörfer liegen. Sie standen einst am Hauptstrom, sind jetzt aber mit diesem vielfach nur noch durch enge Zufahrten verbunden.
Nicht nur an diesem Vorgang wird die gestaltende Kraft des Wassers für die Landschaft und damit den menschlichen Lebensraum am Sepik deutlich. Die enormen Niederschlagsmengen, die jährlich in der Regenzeit fallen, lassen den Strom zwischen Dezember und Mai oft monatelang und kilometerweit über die Ufer treten und verwandeln das Land in eine grosse Wasserfläche, aus der nur die wenigen Hügel (wie zum Beispiel der von Aibom), die Baumkronen und die auf übermannshohen Pfählen stehenden Häuser herausragen. Wasser wird zudem auch durch die grossen südlichen Nebenflüsse herangeführt, die die überaus heftigen Regenfälle am Nordabhang des Zentralgebirges aufnehmen und zusammen mit dem Wasser ihrer eigenen kleinen Nebenflüsse zum Sepik transportieren. So wird es verständlich, dass auch ausserhalb der Regenzeit in unterschiedlichem Masse das Hinterland beiderseits (vor allem aber südlich des Flusses) von zahlreichen versumpften Strecken, schmalen Wasserläufen sowie kleineren und grösseren offenen Wasserflächen (wie zum Beispiel dem Chambri-See) von durchweg geringer Tiefe geprägt wird, Wasser und Land also vielfältig ineinander greifen.
Es ist wichtig, sich diese geographisch-klimatischen Voraussetzungen des mittleren und unteren Sepik-Gebietes zu vergegenwärtigen, weil sie einen wesentlichen Grund für seine historisch-politische Gesamtsituation zu Beginn der 1960er- Jahre bilden, als die in der Ausstellung gezeigten Gegenstände aus den einheimischen Kulturen dort gesammelt wurden. Dieser Teil der gesamten Sepik-Region war damals keine unbekannte und unberührte Wildnis mehr, sondern stand seit mehr als einem halben Jahrhundert in Kontakt mit der - vor allem von den weissen Niederlassungen an der Küste repräsentierten - Aussenwelt, deren Einwirkungen auf die traditionellen einheimischen Kulturen jedoch von den sehr begrenzten damaligen Verkehrsverhältnissen stark eingeschränkt wurden. Die geschilderte Beschaffenheit des Landes erlaubte nicht die Anlage eines zuverlässig und ganzjährig befahrbaren festen Wegnetzes mit den zur Verfügung stehenden technischen und finanziellen Mitteln. So spielte sich der Verkehr zu und zwischen den Dörfern am Fluss und in seinem Hinterland entweder zu Fuss auf schmalen, oft überschwemmten Pfaden ab, oder - weit überwiegend und in der Regenzeit auch innerhalb der Dörfer – mit dem Kanu ab, das mit dem Einblatt-Paddel bewegt wurde, auch geringe Wassertiefen meisterte und zum Beispiel über heran getriebene Grasinseln, die die Wasserwege verstopften, geschoben werden konnte. Die Sepik-Kanus waren Einbäume, mit dem Steinbeil oder eingetauschtem Eisengerät handwerklich perfekt und erstaunlich dünnwandig aus tropischem Hartholz gearbeitet. Vor allem am Bug waren viele kunstvoll geschnitzt, normalerweise als Krokodilkopf, der zugleich eine symbolische Verbindung zum mythischen Urzeitkrokodil herstellt, das im Wasser die Erde trägt wie das Kanu die Menschen. Die grossen Kanus, die Nachfolger der früheren Kriegskanus, boten einer ganzen Reihe von Männern Platz, die im Stehen und mit entsprechend effizientem Krafteinsatz ihre langen Paddel durchzogen, während die Frauen auf ihren Fahrten zum Fischfang oder zum Markt. meist einzeln im Heck ihrer deutlich kleineren Kanus sassen und kürzere Paddel mit breiterem Blatt verwendeten.
Die Ausländer hatten den Aussenbordmotor mitgebracht, der am Heck von Kanus des grösseren Typs an einem Querbrett befestigt war und aus ihnen recht schnelle Flussfahrzeuge für mehrere Personen mit begrenzter, aber durchaus beachtlicher Zuladung machte. Für längere Wege oder Aufenthalte auf dem Fluss benutzte man die wesentlich langsameren Doppelkanus, die ebenfalls von Aussenbordmotoren angetrieben wurden. Sie bestanden aus zwei gleichgrossen, durch eine hölzerne Plattform miteinander verbundenen Kanus, trugen auf dieser Plattform eine Art Hütte mit leichten Seitenwänden und einem Wellblechdach und boten damit die Möglichkeit, monatelang unabhängig von Übernachtungsgelegenheiten am Ufer und einigermassen regengeschützt im Sepik-Flusssystem zu fahren oder zu wohnen und dabei auch grössere Zuladungen wie zum Beispiel die Frankfurter Sepik-Sammlung zu transportieren. Eigentliche Motorboote waren äusserst selten, jedoch fuhren kleine Küstenschiffe gelegentlich den – bei genauer Kenntnis an sich länger schiffbaren – Fluss bis zum Verwaltungsort Angoram am Unterlauf hinauf und nahmen dort auch Ladung zum Transport in die Häfen an der Küste (zum Beispiel Madang) oder zur Weiterverschiffung von dort nach Übersee auf.
Neben der Mobilität wurde auch der Pflanzenwuchs im Sepik-Becken vom amphibischen Zuschnitt der Landschaft wesentlich bestimmt. Charakteristischen Bewuchs bildeten die grossen Bestände an überwiegend wild wachsenden, in kleinerem Umfang aber auch angebauten Sagopalmen, deren Stämme das Grundnahrungsmittel des Gebietes – die aus dem Mark ausgeschwemmte und dann in vielerlei Form zubereitete Sagostärke – in reichem Masse und offenbar ohne merkliche Ertragsschwankungen lieferten. Insofern wurde, soweit wir wissen, der mittlere und untere Sepik nicht von Hungerperioden heimgesucht. Jedoch gab es durchaus Unterschiede in der Ausbeute an Fischen, dem zweiten und kaum minder wichtigen traditionellen Nahrungsmittel, das zudem für die Uferdörfer, die über einen geringeren Bestand an Sagopalmwäldern als die weiter landeinwärts liegenden Dörfer verfügten, das wesentliche Tauschmittel auf den zwischendörflichen Märkten war. Ergänzende Nahrungs- und Genussmittel lieferten mehrere Palmarten, unter ihnen die Kokospalme, deren Anbau – dem Modell der Küste folgend – schon von der deutschen Kolonialverwaltung stark propagiert worden war. Am Sepik war sie jedoch nicht in ausgedehnten Plantagen zu finden, sondern nur in geringerer Anzahl in den Dörfern selbst, und entsprechend wurde auch die Copra-Gewinnung nur vereinzelt betrieben. Den Anbau anderer pflanzlicher Nahrungsmittel in nennenswertem Umfang liessen die Überschwemmungen nicht zu. Knollenfrüchte (wie zum Beispiel der ergiebige Yams) wuchsen nur in höherem Gelände, wie im Washkuk-Hügelland am unteren Ende des Oberlaufs, und auch die von der Verwaltung angeregten und nahe liegend erscheinenden Versuche mit dem Anbau von Nassreis blieben erfolglos. So waren, wenn man von den eindrücklichen Häuserfronten der grossen Dörfer absieht, die naturgegebenen Züge im Landschaftsbild die dominierenden geblieben. Dazu gehörten neben den einzelnen, weithin sichtbaren und durchweg bewaldeten kleinen Hügeln auch die Galeriewälder an den grösseren Wasserläufen und vor allem die ausgedehnten Grasflächen (sowohl auf festem Grund als auch in flachem Wasser), die den Blick in die Ferne bis zu den ersten Erhebungen des Zentralgebirges freigaben
Versucht man, die hier skizzierten lebensräumlichen Aspekte des feuchtheissen mittleren und unteren Sepik-Beckens im Hinblick auf dessen Tauglichkeit als Siedlungsgebiet zusammenzufassen, so lässt sich nach dem Erscheinungsbild zu Anfang der 1960er-Jahre festhalten, dass die einheimische Bevölkerung schon seit langem mit ihren traditionellen Möglichkeiten einen modus vivendi mit den natürlichen Gegebenheiten gefunden hatte. Auf die Erschwerungen, aber auch Erleichterungen, die die Präsenz des Wassers für Verkehr und Transport mit sich brachte, hatte sie mit der Entfaltung einer differenzierten Kanukultur geantwortet, auf die Überflutung der Wohnorte mit der Gestaltung der Wohnhäuser in Form mächtiger Pfahlbauten und auf den Mangel an hochwasserfreien Anbauflächen durch den Ausbau eines ausreichenden Speiseangebotes auf der Basis von Sago und Fisch. Jedenfalls enthalten die Mythen, Wandersagen und im engeren Sinn historischen Erinnerungen zwar eine Fülle von Angaben über Wanderungen von einzelnen bedeutenden Gestalten oder von Sozialgruppen wie Clanen oder Dorfbevölkerungen innerhalb des Sepik-Beckens, jedoch meines Wissens keine Hinweise auf Bemühungen, diesen Lebensraum im ganzen zu verlassen. Dazu war offenbar auch die enorme und zumal in den Perioden steigenden oder fallenden Wassers kaum ertragbare Moskitoplage mit entsprechender Verbreitung der Malaria kein ausreichender Anlass, obgleich als einheimisches Gegenmittel während der besonders schwierigen Nachtzeit nur das Schlafen zu Mehreren in grossen, dicht geflochtenen Schläuchen bekannt war, in die man hintereinander hineinkroch. Erst die DDT-Kampagne der Verwaltung nach 1961 und die schon länger importierten Moskitonetze brachten eine gewisse Erleichterung.
Die stabile Bindung der Einheimischen an ihr Herkunftsdorf und die jeweilige Umgebung hatte leicht nachvollziehbare soziale, ökonomische und emotionale Gründe. Von besonderem Gewicht war jedoch auch die starke lokale Verwurzelung der religiösen Vorstellungswelt und der von ihr getragenen Rituale, die in engstem Bezug zur heimatlichen Umwelt im Ganzen und zu spezifischen natürlichen Elementen (Teilen der Landschaft, Pflanzen- und Tierarten etc.) standen. Es gab zwar seit Jahrzehnten eine temporäre Arbeitsmigration in kleinem Ausmass, die darin bestand, dass junge Männer während ein paar Jahren in den Küstenstädten bei Weissen „auf Station“ arbeiteten. Doch zogen ihnen die Mädchen nicht – wie später – an die Küste nach, um dort ein Familienleben zu führen, sondern die jungen Männer kehrten Pidgin sprechend und mit erweitertem Wissen über die Weissen und den Umgang mit (australischem) Geld an den Sepik zurück und fügten sich in die grossen, nach Hunderten von Mitgliedern zählenden Dorfgesellschaften mit ihren traditionellen Strukturen wieder ein, in denen sie herangewachsen waren. So trat ein nennenswerter Bevölkerungsschwund durch Abwanderung auf der Suche nach neuen, besseren Lebensverhältnissen noch nicht ein, und in den Dörfern waren noch weiterhin alle Altersgruppen vertreten.
Für die weissen Ausländer dagegen war das Sepik-Becken unter den genannten geographischen und klimatischen Bedingungen trotz seines landschaftlichen Reizes ein unwirtliches, als Siedlungs- und Wirtschaftsraum unattraktives Gebiet, in dem die traditionellen, vom Bild des Pflanzers ausgehenden Vorstellungen von einem eigenen unabhängigen Leben in den Tropen nicht zu verwirklichen waren. Weltmarktfähige Produkte wie Kakao und Kaffee, die im Hochland gedeihen, konnten hier nicht angebaut werden, die Copra-Gewinnung war unwirtschaftlich, und so hatten auch Landverkäufe nur in geringem Umfang, zum Beispiel für Gebäude von Verwaltung und Mission, stattgefunden. Entsprechend lag die Zahl der damals anwesenden Weissen sicher unter fünfzig. Es waren Beamte der australischen Kolonialverwaltung, ein Regierungsarzt, Steyler Missionare (SVD), Händler, Handwerker (Schreiner, Schlosser), Krokodiljäger, der Betreiber eines kleinen Hotels in Angoram – Einzelne also, die mit unterschiedlichen Motiven und teilweise nach bewegten bisherigen Lebensläufen aus Australien und europäischen Ländern, aber auch aus den USA, aus Canada und China ins Land gekommen waren und es – mit Ausnahmen – nach ein paar Jahren in Richtung Heimat oder Australien wieder verliessen.
Dass Weisse kamen und gingen und nicht eine wachsende Gruppe von Dauersiedlern mit Landansprüchen bildeten, war den Einheimischen wohlbekannt und zusammen mit der allgemeinen Liberalität und Zurückhaltung der australischen Kolonialverwaltung gegenüber einheimischen Angelegenheiten der wichtigste allgemeine Grund dafür, dass das Verhältnis zwischen Ausländern und Einheimischen weitgehend konfliktfrei war und man sich sicher im Lande bewegen konnte – im Gegensatz zu den vom zwischendörflichen Kriegszustand geprägten früheren Zeiten, in denen sich nach übereinstimmenden Berichten auch für kürzere Besuche in anderen Dörfern der Schutz durch bemannte Kanus empfohlen hatte.
Auch die noch sehr lebendige Erinnerung daran, dass es Amerikaner und Australier waren, die die Sepik-Region vom harten Regiment der japanischen Besatzungsmacht befreit hatten, trug zur entspannten Grundstimmung bei, ebenso der Umstand, dass Einheimische bei Weissen durch Arbeitsleistung und Handel Geld verdienen und damit an die begehrten westlichen Dinge gelangen konnten, die sie mittlerweile kennen gelernt hatten.
Weiterführende Literatur
Münzel, Mark (Hg.) (1987): Neuguinea. Nutzung und Deutung der Umwelt. Roter Faden zur Ausstellung 12, 2 Bände, Museum für Völkerkunde, Frankfurt am Main Sepik. Kunst aus Neuguinea. Aus den Sammlungen des Städtischen Museums für Völkerkunde, Frankfurt am Main 1964
Kaufmann, Christian (1975): Papua Niugini. Ein Inselstaat im Werden. Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweizerische Museum für Volkskunde Basel. Sonderausstellung
Lutkehaus, Nancy; Christian Kaufmann; William E.Mitchell, Douglas Newton, Lita Osmundsen, Meinhard Schuster (Hg.) (1990): Sepik Heritage. Tradition and Change in Papua New Guinea. Durham, North Carolina: Wenner Gren Foundation, Carolina Academic Press
Zum Autor
Prof. Dr. Meinhard Schuster, Studium und Assistentenzeit in Frankfurt von 1948–1965, Museumsbeamter in Basel 1965-1970, ordentlicher Prof. für Ethnologie in Basel von 1970-2000. Feldforschung 1954/55 in Südvenezuela, seit 1961 mehrere Feldforschungen in Papua New Guinea.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008





