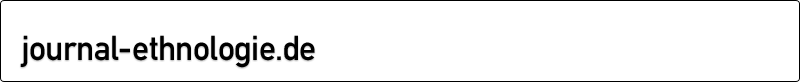
Zwischen Erlebnis und Wissenschaft
Von Brigitta Hauser-Schäublin
Als wir im Oktober 1972 mit dem Kanu im Iatmul-Dorf Kararau ankamen, wurden wir von Kinder und Erwachsene umringt, die uns beim Ausladen des Gepäcks behilflich waren und uns aus der Nähe bestaunen wollten. Plötzlich standen wir nun Menschen derjenigen Bevölkerungsgruppe gegenüber, die wir von Dias, Fotos und zahlreichen Beschreibungen her einigermaßen zu kennen glaubten. Aber die Intensität des direkten Erlebnisses, die mir unverständliche Sprache, die Gesten, die Mimik und der andere Geruch der Menschen verdrängten das vorher erworbene abstrakte Wissen. Aus meiner eigenen Lebenswelt in diese fremde versetzt, hatte ich das Gefühl, dem Pulsschlag des Lebens näher gekommen zu sein.
In den ersten drei Wochen war ich völlig in Bann geschlagen von diesem verwirrend Fremdem, in dessen Strudel ich geraten war, umso mehr als unsere Hütte und wir selbst bei jedem Schritt, den wir im Dorf unternahmen, von einer Schar von Kindern und Erwachsenen umgeben waren. Ich konnte überhaupt keine Ähnlichkeit oder zumindest Anzeichen einer Übereinstimmung der Beschreibungen des Ethnologen Gregory Bateson (1931/32, 1936) mit der von mir erlebten Wirklichkeit feststellen. Erst nach und nach, als es mir gelang, meine eigenen Sinneseindrücke zu ordnen, erhielt ich eine gewisse Distanz zu diesen Menschen, die ich untersuchen sollte.
Hand in Hand damit vollzog sich die Gewinnung von Gewährsleuten und Helfern. Obwohl ich in Hinblick auf das Untersuchungsthema vor allem Kontakt mit Frauen herstellen wollte, hatte ich in den ersten zwei Monaten hauptsächlich mit Männern zu tun, da diese die Gemeinschaft nach außen vertreten und auch im Umgang mit Fremden geübter waren. Zudem hielten sich die Frauen anfänglich scheu zurück und verschwanden in den Wohnhäusern. Die Männer dagegen luden uns beide, meinen Mann und mich, zum Sitzen und Plaudern in den von der Privatsphäre der Wohnhäuser deutlich abgehobenen Männerhäusern ein. Darüber hinaus besaßen einige derjenigen Männer, die, nach einigen Missgriffen, sich als zuverlässige Gewährsleute erwiesen, besonderes Geschick im Formulieren von Antworten auf Fragen, die wir ihnen stellten, oder sie erzählten von sich aus über das Leben in ihrem Dorf – Informationen, die unerlässlich waren, um in einem zweiten Schritt mein Spezialthema behandeln zu können.
Auch wenn sich nach einigen Wochen die Schar der Kinder und Erwachsenen, die uns immer wieder umringten, kleiner wurde, so waren wir weit davon entfernt, ins Dorfleben etwa als gleichwertige Mitglieder integriert zu sein – eine Tatsache, über die ich mir erst viel später Rechenschaft ablegte. Auch eine uns angekündigte Adoption in einen Clan zog mehr Schwierigkeiten nach sich als diese sonst als Akt der Integration interpretierte Handlung zu unserem "Vorteil" in Bezug auf unser Verhältnis zu den Dorfbewohnern gewesen wäre. Manche der älteren Männer vermochten sich an Gregory Bateson zu erinnern und wussten, dass er einen einheimischen Namen erhalten hatte, also adoptiert worden war. So sollte dies nun auch mit uns geschehen.
Als wir merkten, dass es ein ganz bestimmter Clan war, der sich für unsere Adoption einsetzte, besaßen wir keine Möglichkeit mehr, die von uns zuerst freudig begrüßte bevorstehende Handlung zu verhindern. So kam es, dass eines Morgens um sechs Uhr unser zukünftiger Mutterbruder und seine Frau zwei Hühner und noch einige weitere Geschenke brachten und uns feierlich zwei Namen aus der Namensliste seines Clans gaben. Wir schließlich, überrumpelt vom morgendlich-frühen Zeitpunkt – wir hatten uns eher einen mehr oder weniger romantischen Abend in einem Männerhaus oder in der Schummrigkeit des Wohnhauses vorgestellt –, mussten als Gegengabe – wie es sich für Schwesterkinder ziemt – Geldscheine übergeben. Geld war zumindest einer der Gründe, warum uns der betreffende Clan "aufnehmen" wollte. Unsere Gegengabe entsprach, dem enttäuschten Gesicht unseres Mutterbruders nach zu urteilen, nicht seinen Erwartungen, obwohl wir uns vorher bei anderen Männern über die ungefähre Höhe des Betrages, den wir übergeben sollten, erkundigt hatten. Während unseres Aufenthaltes im Dorf suchten uns unser Mutterbruder und seine Verwandten immer wieder auf und verlangten, wir sollten ihnen zeigen, wie wir unser Geld selber herstellen. Alle unsere Erklärungsversuche wurden von Angehörigen dieses Clans nicht akzeptiert.
Dass wir uns nach dieser eher unglücklichen Adoption unseren neuen Verwandten gegenüber nicht den damit verbundenen weitreichenden Verhaltensvorschriften unterwarfen, wurde auch von andern Dorfbewohnern registriert. Uns blieb nicht viel anderes übrig, als unseren "Verwandten" nach Möglichkeit höflich aus dem Weg zu gehen (dass auch der Dorf-„Chef“ zu ihnen zählte, komplizierte das Verhältnis zusätzlich).
Die Adoption erfolgte zu einem Zeitpunkt, da ich erstmals zu einigen Frauen Kontakt aufgenommen hatte. Zuvor hatte ich jeweils den ganzen Tag mit Männern verbracht und dadurch beinahe den Status eines Mannes erlangt. Nur ein einziges Mal hatte ich eine Abschrankung, die bei einem Fest vor einem heiligen Bezirk errichtet worden war, nicht überschreiten dürfen. Im Augenblick, da ich mich mit Frauen zu beschäftigen begann, wurde ich den eher formellen sozialen Verpflichtungen (Beispiel: auf die Bank welchen Clans setze ich mich im Männerhaus?) enthoben, und deshalb fielen die Ausweichmanöver gegenüber unseren männlichen und tonangebenden Verwandten nicht so sehr ins Gewicht. Aber der danach entstehende enge Kontakt mit den Frauen zog nach sich, dass die erwachsenen männlichen Dorfbewohner nicht mehr oder nur noch ungern mir als Gewährsleute zur Verfügung standen.
Mythen wurden mir fast keine mehr erzählt. Dass ich eine Frau war, hatten sie zuvor ja gewusst, aber richtig bewusst wurde es ihnen erst, als ich tage- und wochenlang mit Frauen zusammen war, sie beim Kochen, im Umgang mit ihren Kindern, beim Fischfang und auf dem Weg zum Markt beobachtete und begleitete. Da in der Iatmul-Gesellschaft die Tätigkeiten des Mannes deutlich höher bewertet werden als die der Frau, sank auch ich in der Wertschätzung (der Männer), da ich mich mit den Frauen abgab. Schlimmer war es aber noch, als mich mein Mann oft in die Wohnhäuser der Frauen begleitete, fotografierte oder die Gespräche auf Tonband aufzeichnete. Dass eine Frau sich andern Frauen zuwendet, konnten meine männlichen Informanten begreifen, aber ein Mann ... Nur wenn es darum ging, einen kaputten Außenbordmotor zu reparieren, das Dorf zu vermessen und einen Dorfplan anzufertigen, konnte er sein "Prestige-Manko" wieder einigermaßen aufmöbeln.
Überhaupt befremdete es manchen der Iatmul, dass offensichtlich ich die Befragungen leitete und durchführte und nicht mein Mann (eine Erfahrung, die von uns auch in unserer Gesellschaft gemacht wird). Zu manchen der Iatmul-Frauen hatte ich eine enge Beziehung. Manche dieser Frauen kamen als gesprächsgewandte Informantinnen weniger in Frage, aber durch ihre Herzlichkeit, die sie mir entgegenbrachten, entschädigten sie mich für die weiter oben erwähnten Unannehmlichkeiten, für die ich – und dies möchte ich doch betonen – zumindest mitverantwortlich war.
Einige der älteren Frauen sprachen kein Pidgin. Eines Nachmittags saß ich mit einigen Frauen unter einer Pfahlbauhütte und half ihnen dabei, Tabakblätter auf Rotang aufzuziehen und diesen dann zu verknoten - eine Arbeit, die sie mir wie viele andere mit unendlicher Geduld beibrachten und nie die Hoffnung aufgaben, ich könnte zum Beispiel das Flechten von Taschen doch noch erlernen. Die Frauen sprachen über mich und sahen mich immer wieder an. Dann wiederholte eine ältere Frau immer wieder den gleichen Satz, zeigte auf mich und auf die andern Frauen. Schließlich übersetzte eine jüngere Frau: "Du bist eine Frau, wir sind Frauen; wir werden uns verstehen."
Auf dorfpolitischer Ebene gemessen kam diesem Satz kaum Bedeutung zu, verglichen mit der zuvor erfolgten Adoption, der Aufnahme in das formelle Netz der Verwandtschaftsbeziehungen des Dorfes. Für mich persönlich aber war dieser Nachmittag ein beglückendes Erlebnis. Probleme, die sich aus dem Kontakt mit den Frauen des Dorfes ergaben, lagen im großen Ganzen (von einigen Ausnahmen abgesehen) anders als diejenigen, die sich im Umgang mit deren Ehemännern ergaben.
< Mit einer Frau, Sabwandshan, verband mich so etwas wie Freundschaft, die stärker war als das in anderen Beziehungen sonst wahrscheinlich vorherrschende, gegenseitige Gefühl des Anders-Seins und -Denkens. Bei ihr – und bei einer oder zwei andern Frauen ebenfalls – fühlte ich mich hin- und hergerissen zwischen Freundin oder Ethnologin sein, Sabwandshan erzählte mir einmal, nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann, ihre Lebensgeschichte, die an Dramatik des Inhalts und der Formulierung ein eindrückliches Erlebnis und zugleich eine expressive Meisterleistung darstellte. Ich hatte das Tonband-Gerät bei mir und wusste nicht, sollte ich es einschalten oder nicht. Ich tat es nicht. In diesem Moment wurde mir klar, in welch unmöglicher Doppelsituation ich mich befand als Ethnologin und als "Freundin". Noch einige Male bin ich während unseres Feldaufenthaltes über dieses Problem gestolpert – und bis heute bin ich mir nicht ganz im klaren über die "richtige" Einstellung und Haltung zum Forschungsobjekt Mensch, über die Möglichkeit einer subjektiven Wissenschaftlichkeit und der einer objektiven Unmenschlichkeit.
Überhaupt empfand ich die doppelwertige Position einer Ethnologin (eines Ethnologen) zumindest als kurios: ich griff einige Male ins sogenannte "ungestörte ethnographische Leben" ein, auf das Risiko hin, unethnologisch zu handeln. Einmal, als der Vater seinen erwachsenen, Blut spuckenden Sohn selbst zu heilen versuchte, die Ehefrau uns aber bat, ihren Mann ins Spital zu bringen. Das andere Mal, als der Schwiegervater und der Schwager einer Frau diese buchstäblich aus dem Spital zerrten. Wir hatten sie auf ihre Bitten hin und mit dem Einverständnis der beiden Männer ins Spital gebracht, nachdem sich alle Anzeichen einer Geburt – die Frau war erst im sechsten Monat schwanger – einstellten und der Vorgang nicht mehr aufzuhalten war. Doch die beiden Männer versuchten, noch bevor sich die Fehlgeburt ereignet hatte, die Frau ins Dorf zu schleppen.
Dieses Verhalten meinerseits trug nicht gerade dazu bei, dass ich mich als unauffälliges Mitglied ins Dorfleben eingliedern konnte. - Aber wahrscheinlich war und ist es mehr romantisches Wunschdenken als Realität, völlig integriertes Dorfmitglied werden zu können. Hinzu kommt das von den Einheimischen sicher nur als janusköpfig verstehbare Verhalten meinerseits: einerseits versuchte ich die Dorfbevölkerung davon zu überzeugen, dass für die Bevölkerung ein gesichertes Leben in erster Linie im Dorf möglich sei. In die Stadt abzuwandern, bedeute arbeitslos zu sein, oder sich als ungelernte Arbeitskräfte verdingen zu müssen. Anderseits beschäftigten wir einen Dorfbewohner als "boy", als Gehilfen, der gelegentlich kochte und die Wäsche wusch (Frauenarbeit auch für Iatmul). Für seine Arbeit bezahlten wir ihn mit Geld, demjenigen Wertmesser, der für die Einheimischen große Attraktivität besaß (sie also auch in die Städte lockte) und der die reziproken Beziehungen im Dorf allmählich zu ersetzen begann. Wir besaßen selbst eindrückliche Zeugnisse der westlichen Industriegesellschaft, technische Hilfsmittel wie Außenbordmotor, Photoapparate, Tonbandgeräte, Armbanduhren – und versuchten paradoxerweise die Einheimischen vom Eigenwert ihrer Kultur, von der Ebenbürtigkeit der beiden Kulturen zu überzeugen. Wie schwer war es, abstrakte Werte, wie zum Beispieldie wechselseitigen engen Sozialbeziehungen der Iatmul innerhalb des Verwandtschaftssystems konkreten technischen Errungenschaften unserer Kultur entgegenzusetzen, die für die Iatmul am augenfälligsten waren und mehr zählten als unsere Erklärungsversuche über die (vergleichsweise große) Isolation des Einzelnen in unserer Gesellschaft!
Eigentlich erst jetzt, da ich diese Zeilen schreibe (1975), wird mir das Handeln und Denken unserer „Verwandten“ verständlicher. Es war wohl viel rationaler, als ich mir dies vorgestellt hatte. Und wie viel irrationaler, unbegreiflicher muss wohl mein Verhalten in Kararau gewirkt haben?
Dieser (hier leicht gekürzte Beitrag) wurde 1976 unter dem gleichen Titel im Bulletin der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft veröffentlicht.
Weiterführende Literatur
Bateson, Gregory (1931/32): "Social Structure of the Iatmul People of the Sepik River". Oceania II, 3, 4. S. 245–291 und S. 401–451
Bateson, Gregory (1936): "Naven". Stanford University Press (1958)
Golds, Peggy (Hg.), 1970:"Women in the Field. Anthropological Experiences." Chicago
Hauser-Schäublin, Brigitta (1977): "Frauen in Kararau. Zur Rolle der Frau bei den Iatmul am Mittelsepik, Papua New Guinea." Basler Beiträge zur Ethnologie Band 18. Ethnologisches Seminar und Museum für Völkerkunde Basel
Zur Autorin
Prof. Dr. Brigitta Hauser-Schäublin führte 1972-1973 als Doktorandin von Prof. Dr. Meinhard Schuster (Universität Basel) ihre erste Feldforschung in Papua-Neuguinea durch. Mit dem 1975 geschriebenen Beitrag schnitt sie ein Thema an, das erst viele Jahre später Gegenstand der postmodernen Ethnologie wurden: Die Subjektivität ethnologischer Erfahrung und die Frage nach objektiver Gültigkeit.
Herausgeber © Museum der Weltkulturen, Frankfurt a. M. 2008



